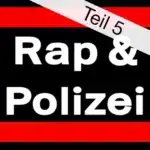Dieser Beitrag dokumentiert das methodische Vorgehen im Forschungsprojekt „Rap und PolizeiDie Polizei ist eine staatliche Institution zur Gefahrenabwehr, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Verfolgung von Straftaten.“. Er beschreibt die Auswahl der Stichprobe, die Datensammlung über die Genius-API, die quantitative Erhebung sowie die Konzeption der qualitativen Inhaltsanalyse.

Dreistufiges Vorgehen: Von der Datensammlung zur qualitativen Auswertung
Das methodische Vorgehen lässt sich in drei Phasen unterteilen. Nach einer Datensammlung und -bereinigung findet zunächst eine qualitative Auswertung des Datenmaterials statt. Anschließend wird eine Zufallsauswahl aus dem Gesamtsample inhaltanalytisch untersucht.
Stichprobenauswahl: Chartplatzierung als Kriterium
Bei der Bestimmung der Gesamtstichprobe dient die Platzierung eines Albums in den offiziellen deutschen Charts in der Kategorie HipHop siehe: https://www.offiziellecharts.de/charts/hiphop als Einschlusskriterium. Dieses Auswahlkriterium garantiert eine gewisse Rezeptionsbreite – auch, wenn genau genommen, bei der Ermittlung von Chartplatzierungen Umsätze und nicht die Reichweite gemessen werden. Natürlich ließen sich theoretisch auch alternative Einschlusskriterien finden (z.B. die „Modus Mio Playlist“ auf Spotify, Anzahl an Streams auf Spotify, Apple Music, Deezer etc., Anzahl der Aufrufe auf YouTube – wobei Klicks auf YouTube auch mittlerweile in die Charts einfließen usw.). Vorteil der Wahl der offiziellen Albencharts ist jedoch, dass hier im Archiv auf die Charts beginnend am 23. März 2015 bis heute zurückgegriffen werden kann. Entsprechend wurde der Untersuchungszeitraum von März 2013 bis März 2022 gelegt. Der lange Untersuchungszeitraum erlaubt es, mögliche Änderungen über die Zeit zu betrachten. So fallen in den Untersuchungszeitraum beispielsweise der gewaltsame Tod von George Floyd oder auch die Debatte über rechtsradikale, rassistische Kräfte innerhalb der deutschen Polizei (siehe z.B. NSU 2.0; Austausch verfassungsfeindlicher Symbole in polizeiinternen Chatgruppen, Debatte über Racial Profiling usw.). Eine untergeordnete Untersuchungsfrage könnte sein, inwieweit solche gesellschaftlichen Debatten Eingang in deutschsprachige Raptexte finden.
Wie entstehen die offiziellen deutschen Charts?
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI) erhoben. Grundlage ist ein umsatzbasiertes Modell: Entscheidend ist, wie viel Umsatz mit einem Song oder Album generiert wurde – nicht die bloße Anzahl der Aufrufe.-
Physische Verkäufe: CDs, Vinyl und Fanboxen gehen vollständig ein. Im Deutschrap wird gezielt mit Sondereditionen gearbeitet, um hohe Platzierungen zu erzielen.
-
Digitale Downloads: Einzelkäufe auf Plattformen wie iTunes zählen gemäß ihrem Preis.
-
Audio-Streaming: Streams bei Spotify, Apple Music & Co. fließen gewichtet ein. Premium-Streams zählen stärker als Free-Streams; erst ab 31 Sekunden zählt ein Stream.
-
YouTube-Streaming: Seit 2022 werden offizielle Musikvideos auf YouTube in die Single-Charts einbezogen – jedoch nicht in die Albencharts.
-
Nicht berücksichtigt: TikTok, Instagram Reels oder andere Kurzvideo-Plattformen zählen nicht – obwohl sie massiv zur Reichweite und Popularität beitragen.
Datensammlung: Liedtexte via Genius-API
In einem ersten Arbeitsschritt werden zunächst alle chartnotierten Alben in dem Untersuchungszeitraum identifiziert und in einem nächsten Schritt unter den insgesamt 1.147 Alben 923 deutschsprachige Alben identifiziert. Anschließemd wurde dann der Versuch unternommen, zu möglichst vielen der 923 Alben die entsprechenden Liedtexte zu sammeln.
Ein mögliches Problem bei der Sammlung und Auswertung von Liedtexten ist die Kontrolle der Datenqualität. Bei der Analyse Tausender Lieder ist es kaum möglich, alle transkribierten Liedtexte auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Bei der Suche nach einer Datenquelle fiel die Wahl auf die Liedtext-Datenbank von genius.com. Nach Aussage des Anbieters handelt es sich um die größte Liedtextsammlung im Internet. Zudem setzt genius.com auf eine Kontrolle der Liedtexte durch langjährige Nutzer und Administratoren, so dass von einer überwiegend guten Datenqualität ausgegangen werden kann. Stichprobenkontrollen haben diese Vermutung bestätigt. Schließlich bietet genius.com eine eine sogenannte API-Schnittstelle (Programmierschnittstelle), die es erlaubt, größere Mengen an Daten automatisiert herunterzuladen.
Qualitätskontrolle und Datenbereinigung
Trotz dieser Automatisierung ist eine händische Kontrolle aller Liedtexte nötig. Wie sich herausstellte, bereiten zum einen deutsche Umlaute bei der automatisierten Datensammlung Probleme. Zum anderen wurden vereinzelt fälschlicherweise Liedtexte geladen, die eine Namensähnlichkeit aufwiesen – jedoch nicht Bestandteile der jeweiligen Alben waren. Schließlich kam es immer wieder zu Abbrüchen beim Datendownload, so dass vorhandene Liedtexte nicht geladen wurden.
Gesamtsample: Umfang und Zusammensetzung
Schlussendlich konnten von den 923 Alben im Untersuchungszeitraum zu 906 Alben Liedtexte in das Untersuchungssample eingeschlossen werden. Bei den 17 übrigen Alben handelt es sich entweder um reine Instrumentalalben oder es fehlen die Liedtexte auf Genius. Insgesamt konnten so 13.203 Liedtexte gesichert werden, die die Gesamtstichprobe (N) darstellen. Die 13.203 erfassten Liedtexte – verteilt auf 906 Alben – entsprechen einer durchschnittlichen Titelzahl von 14,6 pro Album.
Quantitative Auswertung: Polizeibezüge im Rap
In einem zweiten Arbeitsschritt findet eine quantitative Analyse des Datenmaterials statt. Hier gilt es, herauszufinden, ob und wenn ja, in welchem Umfang, die Polizei in Liedtexten thematisiert wird. Hierzu wird eine Volltextsuche bei den als Textdatei gespeicherten Liedtexten vorgenommen. Aufgrund einer Vorstudie mit einem kleineren Untersuchungssample (vgl. Wickert, 2018), kann davon ausgegangen werden, dass die Polizei sehr wohl in deutschsprachigen Liedern thematisiert wird.
Qualitative Auswertung: Kontext und Bedeutung
In einem dritten Arbeitsschritt findet schließlich eine qualitative Auswertung der Polizeibezüge statt. Dieser Schritt ist notwendig, da die reine Feststellung, dass der Begriff Polizei in einem Liedtext auftaucht, keine Schlussfolgerungen über die Qualität der Aussage zulässt. Vielleicht wird das Wort Polizei nur verwendet, weil sich darauf so schön viele Reime finden lassen, vielleicht stellt der Liedtext eine Lobeshymne auf die Arbeit der deutschen Polizei dar, vielleicht wird aber auch Kritik an der Polizei geübt. Dieser letzte Auswertungsschritt folgt dem groben Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse. Um den Besonderheiten der speziellen Textgattung Liedtext gerecht werden zu können, orientiert sich die Auswertung an der Arbeit von Machin (2013).
Es wird angestrebt, eine Zufallsauswahl von ca. zehn Prozent des Gesamtsamples zu codieren.
Einschränkungen des Forschungsdesigns
Wie jede Methode hat natürlich auch die Analyse von Liedtexten ihre Grenzen und Nachteile. Die Konzentration auf Liedtexte bedeutet, dass keine oder nur sehr begrenzte Aussagen zur Wirkung auf die Hörerinnen und Hörer möglich sind. Denn es kann nicht mit Gewissheit gesagt werden, ob z.B. ein Album überhaupt und wenn ja, von welchen und wie vielen Personen gehört wird, ob ein Hörer dem Text Beachtung schenkt, wie ein Text verstanden oder eine Metapher dechiffriert wird. Der beschriebene Forschungsansatz ist daher klar von einer Medienwirkungsforschung abzugrenzen. Im Mittelpunkt steht hier alleine das künstlerische Werk. Mit Blick auf die jeweiligen Rezipientinnen und Rezipienten können allenfalls vorsichtige Mutmaßungen angestellt werden – eine systematische Wirkungsanalyse bleibt demnach Gegenstand zukünftiger Forschung.
Literatur
- Machin, D. (2013). Analyzing Popular Music: Image, Sound, Text (Repr. of the 2010 Ed). Sage.
- Wickert, C. (2018). “Ich hab’’ Polizei“ – Die Darstellung der Polizei in deutschsprachigen Rapliedern.” In A. Mensching & A. Jacobsen (Hrsg.), Empirische Polizeiforschung XXI: Polizei im Spannungsfeld von Autorität, Legitimität und Kompetenz (Issue Band 24, S. 163–183). Verlag für Polizeiwissenschaft.