Musik spielt im Leben der meisten Menschen eine zentrale Rolle – in der Wissenschaft jedoch bleibt sie oft randständig. Besonders in der KriminologieKriminologie ist die interdisziplinäre Wissenschaft über Ursachen, Erscheinungsformen und gesellschaftliche Reaktionen auf normabweichendes Verhalten. Sie untersucht insbesondere Prozesse sozialer Kontrolle, rechtliche Rahmenbedingungen sowie individuelle und strukturelle Einflussfaktoren. fristet sie ein Schattendasein, obwohl sie ein ausdrucksstarkes Medium sozialer Erfahrung, kultureller Aushandlung und politischer Artikulation darstellt.
Im Alltag begleitet Musik viele von uns beinahe ununterbrochen: vom morgendlichen Radio über individuell kuratierte Playlists im Auto, im Fitnessstudio oder beim Einschlafen. Musik kanalisiert Emotionen, weckt Erinnerungen, strukturiert Zeit und Raum. Sie ist Soundtrack unserer Biografien – in euphorischen ebenso wie in schmerzhaften Momenten.
Doch Musik wirkt nicht nur auf der individuellen Ebene. Sie ist auch ein sozialer Marker, der auf Klassen-, Geschlechter- und Milieugrenzen verweist. Die Konnotationen reichen von der als „hochkulturell“ geltenden klassischen Musik oder dem Jazz bis hin zur PopulärkulturKulturelle Ausdrucksform breiter Bevölkerungsschichten; oft massenmedial verbreitet und kommerziell produziert., deren massenkompatible Ästhetik häufig als weniger anspruchsvoll abgewertet wird. Wer was hört – und wie – ist häufig eine Frage des sozialen Habitus.
Musik trägt zudem Geschlechterbilder und dient als Medium des Empowerments, etwa in Form von feministischen Hymnen, Girlie-Pop oder queerer Clubmusik. Sie kann nationale Identitäten festigen oder infrage stellen, sie kann Grenzen überschreiten, kulturelle Stereotype reproduzieren – oder durchbrechen. In einer globalisierten Musiklandschaft verfließen Genregrenzen, während lokale Szenen eigene Varianten globaler Stile hervorbringen: glokale Musikkulturen entstehen, etwa im Rap, Reggaeton oder Afrotrap.
Musik ist auch Widerstand: von der afroamerikanischen ProtestmusikMusik, die soziale Missstände anprangert und politisch-emanzipatorische Forderungen artikuliert. über Punk bis hin zu politischen Chansons, Gefängnisliedern oder Subkulturen wie Drill, Grime oder Gangsta-Rap. Sie artikuliert gesellschaftliche Marginalisierung, staatliche Gewalt und kollektive Empörung. Musik spricht – auch dann, wenn andere Stimmen überhört oder zum Schweigen gebracht werden.
Gleichzeitig verweist das Auditive auf dunklere Seiten sozialer Kontrolle: Musik und Klang werden auch als Instrumente von Disziplinierung und Gewalt eingesetzt – etwa durch Schallkanonen bei Protesten, durch gezielte Lärmbelastung in urbanen Räumen oder durch sogenannte Musikfolter in Gefängnissen und bei Verhören. Die Grenzen zwischen akustischer Ästhetik, Kontrolle und Zwang verlaufen dabei fließend.
Die auditive Kriminologie nimmt diese Phänomene ernst. Sie fragt nach den Bedeutungen, Funktionen und Wirkungen von Musik im Kontext von DevianzVerhalten, das in einer Gesellschaft als unangemessen, abweichend oder regelverletzend gilt – unabhängig davon, ob es strafrechtlich relevant ist., Kontrolle und sozialer Ordnung. Sie interessiert sich für Kriminalitätsdarstellungen in Liedtexten, für musikalische Protestformen ebenso wie für die klangliche Inszenierung von MachtMacht bezeichnet die Fähigkeit von Personen oder Gruppen, das Verhalten anderer zu beeinflussen – auch gegen deren Willen. – im Gefängnis, auf der Straße oder im Club.
„what people listen to is more important for their sense of themselves than what they watch or read. Patterns of music use provide a better map of social life than viewing or reading habits. Music just matters more than any other medium“
– Simon Frith (2003, S. 100 f., Hervorhebung im Original)
Definition
Die auditive Kriminologie untersucht die Darstellung von Kriminalität, Polizei, Gewalt und Devianz in Musik, Klang und akustischer Popkultur. Sie verbindet Elemente der Cultural CriminologyCultural Criminology ist ein kriminologischer Ansatz, der Kriminalität und soziale Kontrolle als kulturell geprägte Phänomene versteht und analysiert. Im Fokus stehen die Bedeutungen, Symbole und gesellschaftlichen Diskurse, die Kriminalität umgeben., der Medienkriminologie und der Narrativen Kriminologie.
Projekte
Kriminologie und Musik
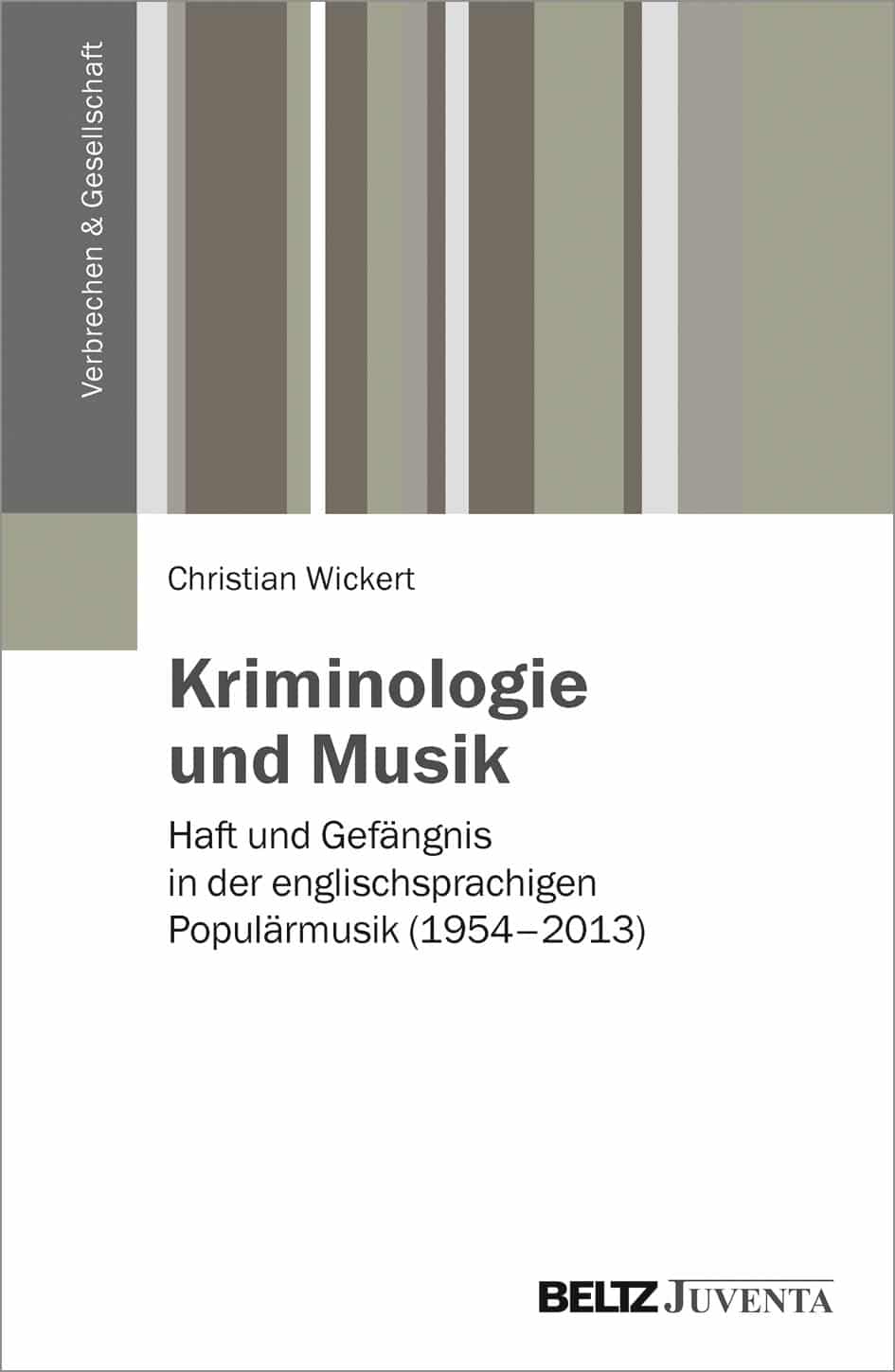
Im Zentrum der Studie steht eine umfangreiche inhaltsanalytische Untersuchung englischsprachiger Musik, in der systematisch erfasst wird, in welchen musikalischen Genres und mit welcher thematischen Ausrichtung über Haft und Gefängnis gesungen wird. Dabei zeigt sich, ob Hafterfahrungen vorwiegend anklagend, mahnend, emotional oder gar verherrlichend dargestellt werden – und welche gesellschaftlichen Vorstellungen von StrafeStrafe ist eine soziale Reaktion auf normabweichendes Verhalten, bei der ein als negativ bewertetes Übel zugefügt wird – entweder informell durch soziale Gruppen oder formal durch staatliche Institutionen. und Gerechtigkeit sich darin spiegeln.
Die Arbeit leistet nicht nur einen Beitrag zur Songtextanalyse, sondern zeigt exemplarisch, wie populäre Musik als Spiegel gesellschaftlicher Machtverhältnisse, NormenVerhaltensregeln und Erwartungen, die innerhalb einer Gesellschaft oder sozialen Gruppe als verbindlich gelten. und Ausgrenzungsmechanismen fungiert – und damit kriminologisch höchst relevant ist.
Rap und PolizeiDie Polizei ist eine staatliche Institution zur Gefahrenabwehr, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Verfolgung von Straftaten.

Das Projekt verbindet Ansätze der auditiven Kriminologie mit polizeiwissenschaftlichen Fragestellungen zur institutionellen AutoritätAutorität bezeichnet anerkannte, legitime Macht, die auf Zustimmung und Vertrauen basiert., zur Vertrauenswürdigkeit der Polizei und zur gesellschaftlichen Legitimationskrise staatlicher Kontrolle. Gerade im Rap – einem musikalischen Genre, das traditionell als Stimme marginalisierter Gruppen fungiert – wird das Verhältnis zur Polizei häufig konfliktgeladen, ambivalent oder offen ablehnend thematisiert.
Die Analyse offenbart nicht nur, wie tief kulturelle Erfahrungen von Kontrolle, Ausgrenzung und Racial ProfilingEine polizeiliche Praxis, bei der Personen allein aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, Hautfarbe oder Religion kontrolliert oder verdächtigt werden, ohne dass es konkrete Hinweise auf eine Straftat gibt. in den musikalischen Erzählungen verankert sind, sondern auch, welche alternativen Deutungen von Recht, Gerechtigkeit und Widerstand formuliert werden. Damit leistet die Studie einen Beitrag zur Erforschung der popkulturellen Aushandlung von Machtverhältnissen und zur öffentlichen Wahrnehmung der Polizei im medialen Diskurs.
Zum vollständigen Projektbericht
Forschungsüberblick
Der Cultural Turn und die Rückkehr des Sinns in der Kriminologie
Ein für das Ende der 2000er Jahre zu diagnostizierender Cultural Turn in den Sozialwissenschaften (vgl. Bachmann-Medick, 2006), der das Visuelle, den Raum oder das Auditive als zentrale Analysekategorien in den Mittelpunkt rückt, findet in der Kriminologie seinen Ausdruck in der steigenden Beschäftigung mit dem Beziehungsgeflecht aus KriminalitätKriminalität bezeichnet gesellschaftlich normierte Handlungen, die gegen das Strafgesetz verstoßen., Kontrolle und Kultur – insbesondere im Rahmen der Cultural Criminology (vgl. Ferrell et al., 2015; Ferrell & Sanders, 1995; Presdee, 2000), der Visual Criminology (vgl. Hayward & Presdee, 2010) sowie der Sensory Criminology (vgl. McClanahan & South, 2020).
Diese Forschungsrichtungen stehen im Zeichen eines interpretativen Paradigmas und knüpfen an medienkritische Perspektiven an, wie sie etwa am Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) der Universität Birmingham entwickelt wurden. Hier werden jugendliche Subkulturen als Ausdruck symbolischer Auseinandersetzungen mit hegemonialen Ordnungen verstanden.
Begriffsklärung: Auditive Criminology und Musicriminology
Vor diesem theoretischen Hintergrund hat sich eine wachsende Zahl an Studien mit der Rolle von Musik und Klang im kriminologischen Kontext beschäftigt. Dabei sind die Begriffe „auditive criminology“ (Hayward, 2012), „auditive Kriminologie“ (Wickert, 2017a, 2017b) und „Musicriminology“ (Lee, 2021) entstanden, die unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb desselben Forschungsfeldes setzen.
Während sich die Musicriminology vor allem auf Liedtexte, musikalische Ästhetik und SubkulturEine Subkultur bezeichnet eine Gruppe innerhalb einer Gesellschaft, die sich durch abweichende Werte, Normen, Verhaltensweisen oder symbolische Ausdrucksformen von der Mehrheitskultur unterscheidet. bezieht – als „texts of resistance, marginalisation, redemption, criminalisation, or soundtracks of deviancy“ (Lee, 2021, S. 3) – erweitert die auditive Kriminologie den Blick auf Sound, Geräusche und Klanglandschaften. Dazu zählen z. B. Sirenen, urbane Lärmzonen, akustische Überwachung, Schallwaffen oder Musikfolter (Johnson & Cloonan, 2008). Das Auditive erscheint hier nicht nur als Ausdrucksform, sondern auch als Instrument der Kontrolle, Exklusion oder Disziplinierung.
Liedtextanalysen und kriminologische Subkulturforschung
Einen festen Platz innerhalb der auditiven Kriminologie nehmen Studien zur Analyse von Liedtexten ein – insbesondere im Bereich des US-amerikanischen und britischen Rap. Zu den einschlägigen Arbeiten zählen die von Kubrin (2005a, 2005b), Henderson & Steinmetz (2016) sowie Steinmetz & Henderson (2012), die untersuchen, wie Musik Identität, Devianz, Gewalt und soziale Ungleichheit thematisiert.
Diese Studien greifen häufig auf Konzepte wie den „Code of the Street“ (Anderson), narrative Identitätskonstruktionen oder performative Männlichkeitsinszenierungen zurück. Die Songtexte werden dabei nicht nur als ästhetische Produkte, sondern als soziale und politische Aussagen verstanden – eingebettet in konkrete Erfahrungsräume, etwa in marginalisierten Stadtvierteln oder Jugendkulturen. Diese Perspektive spiegelt sich theoretisch in der Narrative Criminology wider.
Repression, Realness und die KriminalisierungDer Prozess, durch den bestimmte Handlungen oder Verhaltensweisen durch gesetzliche Bestimmungen als kriminell definiert und strafrechtlich verfolgt werden. von Künstler:innen
Ein weiterer Strang der Forschung widmet sich der Kriminalisierung von Musik und Musiker:innen. Besonders im Kontext von Drill und Grime (Großbritannien) oder Gangsta-RapSubgenre des Hip-Hop, das Gewalt, Straßenerfahrung, Macht und Marginalisierung thematisiert. (USA) wird deutlich, wie Musik als Bedrohung markiert und polizeilich verfolgt wird. Fatsis (2019) und Ilan (2020) analysieren, wie staatliche Akteure gegen bestimmte Subgenres vorgehen, Konzertverbote erteilen oder Inhalte auf Social Media überwachen.
Ein alarmierender Trend ist die juristische Verwendung von Rap-Texten als Beweismittel vor US-amerikanischen Gerichten (vgl. Nielson & Dennis, 2019). Die Texte werden dabei aus dem künstlerischen Kontext gelöst und als Schuldeingeständnisse oder Gewaltandrohungen interpretiert – mit oft rassistischen Implikationen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach „Realness“ im Rap: der Erwartung, dass Künstler:innen das leben, was sie rappen – und die sich in Gerichtsverfahren gegen sie wendet.
Für den deutschsprachigen Raum ist die Arbeit von Dams (2012) hervorzuheben, die sich mit der Darstellung der Polizei in populären deutschsprachigen Liedern beschäftigt und damit ein frühes Beispiel für eine deutschsprachige auditive Kriminologie darstellt.
Literatur
- Bachmann-Medick, D. (2006). Cultural Turns: Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Cusick, S. G. (2009). Music as Torture / Music as Weapon. Transcultural Music Review.
- Dams, C. (2012). Polizei, Protest und Pop. Staatliche Ordnungsmacht und gesellschaftliches Aufbegehrenin der Popularmusik seit 1970. In S. Mecking & Y. Wasserloos (Hrsg.), Musik – Macht – Staat. Kulturelle,, soziale und politische Wandlungsprozesse in der Moderne (S. 303–318). V&R unipress.
- Fatsis, L. (2019). Grime: Criminal subculture or public counterculture? A critical investigation into the criminalization of Black musical subcultures in the UK. Crime, Media, Culture, 15(3), 447–461. https://doi.org/10.1177/1741659018784111
- Ferrell, J., Hayward, K., & Young, J. (2015). Cultural criminology: an invitation. SAGE.
- Ferrell, J., & Sanders, C. (Hrsg.). (1995). Cultural criminology. Northeastern University Press.
- Frith, S. (2003). Music and Everyday Life. In M. Clayton, T. Herbert, & R. Middleton (Hrsg.), The Cultural Study of Music (S. 92–112). Routledge.
- Hayward, K. J. (2012). Five Spaces of Cultural Criminology. British Journal of Criminology, 52(3), 441–462. https://doi.org/10.1093/bjc/azs008
- Hayward, K. J., & Presdee, M. (Hrsg.). (2010). Framing crime: cultural criminology and the image. Routledge.
- Henderson, H., & Steinmetz, K. (2016). Hip-Hop’s Criminological Thought: A Content Analysis. Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 18(1), 114–131. https://www.researchgate.net/publication/316109114
- Ilan, J. (2020). Digital Street Culture Decoded: Why criminalizing drill music is Street Illiterate and Counterproductive. British Journal of Criminology, 60(4), 994–1013. https://doi.org/10.1093/bjc/azz086
- Johnson, B., & Cloonan, M. (2008). Dark side of the tune: popular music and violence. Ashgate.
- Kubrin, C. E. (2005a). Gangstas, Thugs, and Hustlas: Identity and the Code of the Street in Rap Music. Social Problems, 52(3), 360–378. https://doi.org/10.1525/sp.2005.52.3.360
- Kubrin, C. E. (2005b). “I See Death around the Corner”: Nihilism in Rap Music. Sociological Perspectives, 48(4), 433–459. https://doi.org/10.1525/sop.2005.48.4.433
- Lee, M. (2021). This Is Not a Drill: Towards a Sonic and Sensorial Musicriminology. Crime, Media, Culture. https://doi.org/10.1177/17416590211030679
- McClanahan, B., & South, N. (2020). ‘All Knowledge Begins with the Senses’: Towards a Sensory Criminology. The British Journal of Criminology.
- Nielson, E., & Dennis, A. L. (2019). Rap on Trial. Race, Lyrics, and Guilt in America. The New Press.
- Presdee, M. (2000). Cultural criminology and the carnival of crime. Routledge.
- Steinmetz, K. F., & Henderson, H. (2012). Hip-Hop and Procedural Justice: Hip-Hop Artists’ Perceptions of Criminal Justice. Race and Justice, 2(3), 155–178. https://doi.org/10.1177/2153368712443969
- Thompson, M. (2017). Sound, Music, Affect: Theorizing Sonic Agency. Bloomsbury.
- Wickert, C. (2017a). Auditive Kriminologie. Verbrechensdarstellung in Liedtexten aus der angloamerikanischen Musiktradition. Juridikum, 1, 90–99.
- Wickert, C. (2017b). Kriminologie und Musik: Haft und Gefängnis in der englischsprachigen Populärmusik (1954-2013).


