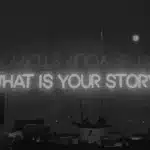Was steckt hinter der häufig kritischen Darstellung der Polizei im Gangsta-RapSubgenre des Hip-Hop, das Gewalt, Straßenerfahrung, Macht und Marginalisierung thematisiert.? Dieser Beitrag analysiert zentrale Narrative polizeikritischer Raptexte und beleuchtet ihre gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Kontexte.
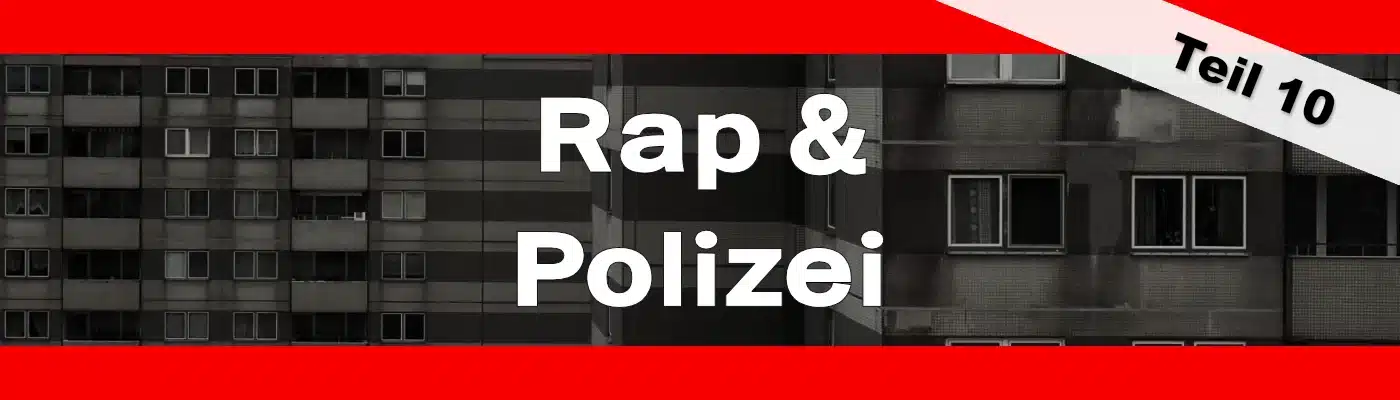
Das Bild der Polizei im Gangsta-Rap: Warum ist sie ein Feindbild?
Die Analysen der Liedtexte haben gezeigt, dass es drei zugrundeliegende Motive für eine polizeikritische oder teilweise auch polizeiablehnende Haltung gibt:
1. Skandalisierung von polizeilichem Fehlverhalten
Immer wieder weisen Rapper auf illegitimes und teilweise illegales Handeln seitens der Polizei hin und skandalisieren Fälle von Korruption, übermäßiger Polizeigewalt und Racial ProfilingEine polizeiliche Praxis, bei der Personen allein aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, Hautfarbe oder Religion kontrolliert oder verdächtigt werden, ohne dass es konkrete Hinweise auf eine Straftat gibt.. Die Aussagen, die sich mitunter auf wahre Begebenheiten beziehen oder auf vorgebliche eigene Erfahrungen beruhen, werden oft verallgemeinert. Somit wird unterstellt, dass auch andere Hörerinnen und Hörer ähnliche negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben1Dies zeigt sich beispielsweise an dem Wechsel der Erzählperspektive vom „Ich“ hin zum „Wir“, womit der Erzähler signalisiert, dass seine persönlichen Erfahrungen auch von seiner Hörerschaft gemacht wurden (vgl. Wickert, 2018). . Tatsächlich weisen Forschungsergebnisse darauf hin, dass Menschen mit Migrationshintergrund und People of Color (PoC) verstärkt von selektiven und diskriminierenden Kontrollpraktiken betroffen sind (vgl. Abdul-Rahman et al., 2020). Auch wenn eine detaillierte Auswertung aufgrund methodischer Schwierigkeiten nicht erfolgt ist, so ist doch eindeutig, dass viele der im Untersuchungssample vertretener Rapperinnen und Rapper einen Migrationshintergrund aufweisen. Inwieweit, dass auch für die Hörerschaft zutrifft, kann nicht bestimmt wird. Eine Verallgemeinerung betrifft nicht nur die vermeintlichen Opfer von PolizeigewaltPolizeigewalt beschreibt den Einsatz physischer oder psychischer Gewalt durch Polizeibeamte im Rahmen ihrer Dienstausübung. Sie kann sowohl legitim (im rechtlichen Rahmen) als auch illegitim (bei Überschreitung der Befugnisse) ausgeübt werden. und Diskriminierungen, sondern auch die Polizei selbst. Jede Polizistin und jeder Polizist ist Rollenträger, d.h., das Handeln der einzelnen Polizistin oder einzelnen Polizisten färbt ab auf die Institution Polizei in ihrer Gesamtheit. Die Polizei wird sodann gemessen an ihren schlechtesten Mitgliedern und ihren größten Verfehlungen. Eine Differenzierung und Individualisierung finden hier nicht (oder kaum) statt2In seinem Lied CopKKKilla (2015) rappt Haftbefehl: „Und fünf von zehn Polizisten Hurensöhne“ verallgemeinert aber anderer Stelle und sagt: „Die Rauschgiftfahndung ist korrupt, so wie der Zoll“.. Interessanterweise ist diese Tendenz zur Generalisierung einer Polizeikritik eine quasi gegenläufige Unterstellung zur Einzelfall-These. Nach dieser von Polizei-Offiziellen und in der Politik geläufigen Ansicht, liegen die Ursachen für ein polizeiliches Fehlverhalten immer auf individueller Ebene nie aber auf strukturelle Ursachen begründet (vgl. z.B. Niemz & Singelnstein, 2022 oder Rinn et al., 2020). Die Generalisierung polizeilichen Fehlverhaltens dient auch als Rechtfertigung für das eigene deviante Verhalten. Sykes und Matza (1968) bezeichnen diese Technik der Neutralisierung treffend als „Verdammung der Verdammenden“ (Condemnation of the Condemners). Das eigene Verhalten wird gemessen an dem Verhalten und der Moral derjenigen, die das Verhalten des Delinquenten missbilligen. Wenn also eine korrupte Polizei sichergestellte DrogenDrogen sind psychoaktive Substanzen, die das zentrale Nervensystem beeinflussen und in legaler oder illegaler Form konsumiert werden. unterschlägt, erscheint der eigene Drogenkonsum und Handel mit Drogen moralisch gerechtfertigt. In einem vielzitierten Ausspruch nannte Chuck D, Gründungsmitglied von Public Enemy, Hip-Hop „the Black CNN“ (Alim et al., 2023, S. 39)]. Die Aufgabe bestünde darin „informing people, connecting people, being a direct source of information“ (Mahoney, 2010). Durch finanziell erschwingliche Wege der Musikproduktion bestünden auch keine technologischen Hürden, seiner Wut Gehör zu verschaffen. Marginalisierte Gruppen, deren Anliegen in den Massenmedien nicht repräsentiert würden, könnten im Hip-Hop ein Sprachrohr finden und über Social Media fernab etablierter Medienanstalten eine Hörerschaft finden. Dies gilt auch für einige der hier untersuchten deutschsprachigen Liedtexte, die über polizeiliches Fehlverhalten, Machtmissbrauch, illegitime Gewaltanwendung und Korruption aufklären. Diese Liedtexte haben einen hohen Nachrichtenwert zumal, wenn die Rapper über ein hohes Maß an Authentizität und Glaubwürdigkeit in der Szene verfügen. Die Skandalisierung polizeilichen Fehlverhaltens ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Es wird eine Hörerschaft über eine illegitime/ illegale Ausweitung der polizeilichen Machtbefugnisse informiert, die sich hierüber vielleicht nicht unbedingt in der Tagespresse oder Nachrichtensendungen im Radio und TV informiert hätte. Problematisch hingegen ist, dass im Gegensatz zu klassischen Nachrichtenkanälen ein Liedtext keinerlei Qualitätskontrolle unterliegt. Die Grenzen zwischen dem Faktualen und dem Fiktiven können verschwimmen. Ein bekanntes Beispiel, dass diese Schwierigkeit illustriert, stammt von dem US-amerikanischen Rapper Jay-Z. In seinem Lied „99 Problems“ (2004) berichtete er aus der Ich-Perspektive von einer Polizeikontrolle. Der Ich-Erzähler hegt den Verdacht, die Kontrolle würde alleine aufgrund seiner phänotypischen Erscheinung durchgeführt („’Cause I’m young and I’m black and my hat’s real low?“ und ) und verweigert sich unter Berufung auf den 4. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten den Anweisungen des kontrollierenden Polizisten Folge zu leisten („I ain’t steppin‘ out of shit, all my paper’s legit“ und „Well, my glove compartment is locked, so is the trunk in the back / And I know my rights, so you gon‘ need a warrant for that“). Der Liedtext lässt sich als plausibel klingender Rechtsratgeber verstehen. Problematisch ist jedoch, dass das von Jay-Z beschriebene Verhalten einer rechtlichen Prüfung nicht standhält (vgl. Mason, 2012). Schließlich sind ebenfalls die pauschale Abwertung und Generalisierung als problematisch zu betrachten. Wenn junge Männer mit einer Migrationsbiographie sich ungerechtfertigten Kontrollen ausgesetzt sehen und daraufhin ihre pauschale Ablehnung der Polizei zur Schau tragen, ist nicht mit einer gütlichen Annäherung beider Seiten zu rechnen. Statt Dialog und Verständnis für die Probleme und Sorgen der anderen Seite, bleibt unreflektierter Hass.
2. Polizeikritik als Sozialkritik
Das zweite Motiv für eine polizeikritische Haltung im deutschsprachigen Gangsta-Rap ist hier mit dem Begriff Sozialkritik umrissen. Es stellt das häufigste Narrativ dar, das sich in einer Vielzahl von Liedtexten wiederfindet. Dieses Motiv steht in einer engen Beziehung zu den Auswertungskategorien „soziale Lage“, „Ort“, „psychische Probleme“ wie auch „deviantes Verhalten“ und „Luxus“. Dieses Motiv steht in einer über hundertjährigen Forschungstradition, die den Zusammenhang zwischen Wohnlage und sozialer Lage betont3Für einen Überblick siehe: Ilan, 2015, S. 22 ff.. Bereits Engels wies auf den Prozess der SegregationDie räumliche, soziale oder wirtschaftliche Trennung von Bevölkerungsgruppen innerhalb einer Gesellschaft. hin und beschrieb die in Folge der Industrialisierung entstandenen Arbeiterquartiere mit den Worten:
Jede große Stadt hat ein oder mehrere ‚schlechte Viertel‘, in denen sich die arbeitende Klasse zusammendrängt. Oft freilich wohnt die ArmutArmut beschreibt den Mangel an materiellen, sozialen und kulturellen Ressourcen, die notwendig sind, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. in versteckten Gäßchen dicht neben den Palästen der Reichen; aber im allgemeinen hat man ihr ein apartes Gebiet angewiesen, wo sie, aus den Augen der glücklicheren Klassen verbannt, sich mit sich selbst durchschlagen mag, so gut es geht. (Engels 1976 [1845]: 259)
Von der Street Corner Society bis zur Cultural CriminologyCultural Criminology ist ein kriminologischer Ansatz, der Kriminalität und soziale Kontrolle als kulturell geprägte Phänomene versteht und analysiert. Im Fokus stehen die Bedeutungen, Symbole und gesellschaftlichen Diskurse, die Kriminalität umgeben.
In den 1920er Jahren betonten Forscher der Chicago School of Sociology die Relevanz informeller Netzwerke und Beziehungen, die im Widerspruch zur formalen Bürokratie stehen können (vgl. Park und Burgees, 1925). In ihrer Theorie der sozialen Desorganisation arbeiten Shaw und McKay (1942) heraus, dass die Kriminalitätsbelastung (gemäß dem statistischen HellfeldDer Teil der Kriminalität, der polizeilich bekannt und in Statistiken wie der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst wird.) über ein Stadtgebiet nicht gleichverteilt ist, sondern insbesondere in jenen Gebieten zum Vorschein tritt, die sich durch eine hohe Bevölkerungsfluktuation und einen hohen Anteil von Migrantinnen und Migranten unter der Wohnbevölkerung auszeichnen. Eine mangelnde soziale Kohäsion und fehlende soziale Kontrolle werden hier als Erklärung für eine hohe Kriminalitätsbelastung gegeben. Über diese Arbeiten der Chicago School hinaus gibt es zahlreiche kriminalsoziologische Ansätze, die einen Zusammenhang von KriminalitätKriminalität bezeichnet gesellschaftlich normierte Handlungen, die gegen das Strafgesetz verstoßen. auf der einen und Wohnort, sozialer Lage und Straßenkultur auf der anderen Seite betonen – sei es z.B. Whyte (1943) mit seiner ethnographischen Untersuchung einer „Street Corner Society“, die Entwicklung einer kriminologischen Subkulturtheorie (Cohen, 1955), die Arbeit von Miller (1958) zur Kultur der Unterschicht als ein Entstehungsmilieu für Bandendelinquenz, Arbeiten zum Zusammenhang von sozialer Klasse, Style, SubkulturEine Subkultur bezeichnet eine Gruppe innerhalb einer Gesellschaft, die sich durch abweichende Werte, Normen, Verhaltensweisen oder symbolische Ausdrucksformen von der Mehrheitskultur unterscheidet. und Devianz, die aus der Birmingham School of Contemporary Cultural Studies hervorgegangen sind (z.B. Hebdige, 1979), Youngs Arbeiten zum Thema sozialer Exklusion und Kriminalität (z.B. 1999), Andersons ethnographische Arbeit zum „Code of the Street“ (1999) sowie weitere unzählige Arbeiten aus dem Umfeld der Cultural Criminology (Ferrell et al., 2015) und viele weitere mehr. Der spezifische Zusammenhang von Gangsta-Rap und sozialer Lage wird von zahlreichen Autoren betont (Ilan, 2015; Kubrin, 2005; Lütten & Seeliger, 2017; Seeliger 2021; Seeliger & Sahr, 2022). Hierbei wird teilweise unter Bezugnahme auf die zuvor genannten Forschungsarbeiten vor allem auf zwei zentrale Themen abgestellt:
- Der Zusammenhang zwischen der Popularität von Gangsta-Rap und der Entstehung bzw. dem Anwachsen der sozialen Klasse des Prekariats
- Der Zusammenhang eines neoliberalen Ideals und seiner Spiegelung in typischen Themen und Motiven im Gangsta-Rap
In der Soziologie wird seit Jahren im Kontext von sozialer Ungleichheit über die Entstehung einer neuen Klasse diskutiert. Autorinnen und Autoren betonen, dass bei der Analyse sozialer Lagen vertikale Unterschiede wieder vermehrt zutage treten. Diese Entwicklung wird unter den Stichworten Prekariat bzw. PrekarisierungZunahme unsicherer, instabiler und schlecht abgesicherter Lebens- und Arbeitsverhältnisse. (als Wortkombination von prekär und Proletariat) (Castel & Dörre 2009; Manske & Pühl 2010), Exklusion, Ausgrenzung von „Überflüssigen“, „Ausgeschlossenen“ (Bude & Willisch 2006, 2008; Bude 2008; Kronauer 2010) oder auch einer „neuen Unterschicht“ (Chassé 2009) gefasst (vgl. Burzan, 2011, S. 147). Nach einer Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) fallen hierunter diejenigen Personen, „die aufgrund ihres Erwerbsstatus nur geringe Arbeitsplatzsicherheit genießen, wenig Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung ihrer Arbeitssituation haben, nur partiell im arbeitsrechtlichen Schutzkreis stehen und deren Chancen auf materielle Existenzsicherung durch Arbeit in der Regel schlecht sind“ (Vogel, 2008). Aus dieser Perspektive stellen sich die Themen und Aussagen im Gangsta-Rap, die Dollinger und Rieger (2023) mit „from rags to riches“ treffend umschreiben, als Reaktion auf fehlende vertikale Mobilität und ein nicht einzulösendes Bildungs- und Aufstiegsversprechen dar. Das im deutschsprachigen Gangsta-Rap vielfach besungene Ghetto ist ein „Ort sozialer Aussichtslosigkeit“ (Vogel, 2008). Das erklärte Ziel vieler Rapper ist es, dem Ghetto zu entkommen und einen sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg zu meistern. Versteht man Gangsta-Rap als „ground-level perspective of circumstances as lived experiences” (Rose, 2008, S. 52), wird in den Liedern Einblick in den Sozialkosmos der von staatlicher Unterstützung Lebenden, Geringverdienern und den ökonomisch wie sozial Abgehängten gewährt. Der „Block“ wird zur Bühne und Arena der demonstrierten Selbstermächtigung (vgl. Gontek, 2024). Dieses Motiv ist eng mit dem Gründungsmythos von Hip-Hop verbunden. Entstanden in den 1970er Jahren in der South-Bronx war Hip-Hop in den Gründungstagen eine Unterschichtenkultur, geprägt durch die Lebensrealität prekär lebender schwarzer und hispanischer Jugendlicher. Der Gangsta-Rapper setzt sich gegen widrige Umstände und eine als feindlich-diskriminierend wahrgenommene Umwelt zur Wehr. Herkömmliche bürgerliche Bildungsbiographien und traditionelle Formen der Erwerbsarbeit werden ablehnt. Der Bruch von informellen wie auch formellen Regeln stellt die eigene Handlungsfähigkeit heraus. Im Idealfall gelingt der soziale und vor allem wirtschaftliche Aufstieg. Der gewonnene Wohlstand wird als Beleg des eigenen Erfolges nach außen demonstriert – in etwa durch die Zurschaustellung von erworbenen Luxusgütern. Ungeachtet wirtschaftlicher Erfolge bleibt jedoch die eigene Herkunft (sowohl im geographischen wie auch sozialen Sinne) stets wichtiger Bezugs- und Referenzpunkt der eigenen Identität. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Unter- und Oberschicht, dem Populären/ Vulgären und der Hochkultur wird mit einem Augenzwinkern von Jay-Z in seinem Lied Picasso Baby (2013) auf den Punkt gebracht.
Uh, I just want a Picasso
In my casa, no, my castle
I’m a hassa, no, I’m an asshole
I’m never satisfied, can’t knock my hustle
I want a Rothko, no, I want a brothel
No, I want a wife that fuck me like a prostitute
Let’s make love on a million
In a dirty hotel with the fan on the ceiling, uh
All for the love of drug dealing, uh
Marble floors, uh, gold ceilings, uh
Oh, what a feeling
Fuck it, I want a billion
Jeff Koons balloons, I just wanna blow up
Condos in my condos, I wanna row of
Christie’s with my missy, live at the MoMA
Bacons and turkey bacons, smell the aroma
Der Polizeiforscher Rafael Behr beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Gewalt und Polizei. Er sieht Gewalt gegen die Polizei als Kommunikationsproblem und anknüpfend an die obigen Ausführungen, Ergebnis einer Resignation bei Teilen der Bevölkerung. Er schreibt:
Die Diskrepanz wird größer zwischen den Einsatzkräften, von denen heute viele mit Abitur zur Polizei gehen und dort gleich die Hochschule besuchen, und dem ‚abgehängten Prekariat‘, das zwar ausgehalten (im doppelten Wortsinn von ertragen und alimentieren), aber weder wertgeschätzt noch gebraucht wird. Doch nehmen (besonders: Schutz-)Polizisten seismographisch genau wahr, dass sich etwas verändert am unteren Rand der GesellschaftEine Gesellschaft ist ein strukturiertes Gefüge von Menschen, die innerhalb eines geografischen Raumes unter gemeinsamen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen leben und durch institutionalisierte soziale Beziehungen miteinander verbunden sind., mit dem sie es meistens zu tun haben. Für sie wird die Arbeit schwerer, weil sich vor allem der Ton und die innere Haltung gegenüber dem Staat verändert hat, weil viele Menschen nicht mehr um ihre eigene Integration in und um Zugehörigkeit zur unteren Mitte der Gesellschaft ringen, sondern von lang anhaltender Exklusion betroffen sind. Mit diesen sozialen Milieus gibt es möglicherweise größere Kommunikationsschwierigkeiten als früher. Polizisten werden nicht auf resignierte und aussichtslose Lebensperspektiven vorbereitet, die nichts mehr mit Gestaltungswillen zu tun haben, aber sehr viel mit Lethargie und Fatalismus. Vielleicht ist es das, was für Polizistinnen und Polizisten deutlicher hervorgetreten ist als früher, dass Resignation keine individuelle Erfahrung von wenigen, sondern das Erkennungsmerkmal einer Klassenlage und somit sozial geworden ist. Resignation geht häufig mit Aggression einher, und das ist ein schwer zu handhabendes Gemisch für Polizisten, die noch nie ein Spiegelbild der Gesellschaft, sondern immer ein Spiegelbild der sozialen Mittelschicht waren. (Behr, 2014, S. 210 f.)
Selbstermächtigung und neoliberale Leistungsideologie
Die Darstellung der eigenen Handlungsfähigkeit und eine zur Schau gestellte Selbstermächtigung (z.B. in Form eines gewaltsamen Handelns gegenüber staatlichen Akteuren) weist Parallelen zu einem neoliberalen Ideal auf. Die Denkrichtung des (Neo-)Liberalismus als freiheitliche, marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung und wirtschaftspolitische Ideologie betont die Freiheit des Einzelnen und lehnt in seiner ursprünglichsten und extremsten Form jedwede staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft ab. Gleichzeitig werden Individualisierung und Privatisierung betont und gefördert. Fernab der Regulierung des Wirtschaftsmarktes durchdringt der NeoliberalismusWirtschafts- und Gesellschaftsmodell, das auf Marktlogik, Deregulierung und Privatisierung setzt und staatliche Eingriffe weitgehend ablehnt. aber auch Alltagskultur. Die propagierte Verantwortlichkeit des Einzelnen führt zu Phänomenen, denen die Suche nach Selbstoptimierung und eine stetige Steigerung der Leistungsfähigkeit zugrunde liegen. Effizienz und Leistungsfähigkeit wird zum normativen Prinzip hochstilisiert (vgl. Seeliger, 2021, S. 126). Angefangen von smarten Endgeräten, mit denen wir die Qualität unseres Nachtschlafes, die Zahl der gelaufenen Schritte und die zu uns genommenen Kalorien erfassen, über Trainings zur Optimierung des Ichs (mehr Selbstvertrauen, mehr Verhandlungsgeschick, bessere Atemtechnik, mehr Erfolg bei der Suche nach gleichgesinnten Sexualpartnern) bis hin zur Optimierung des eigenen Aktiendepots als Bestandteil der privaten Altersvorsorge erfasst ein neoliberaler Geist fast alle Lebensbereiche. Im Gangsta-Rap findet dieses die Alltagskultur perpetuierende neoliberale Ideal in einer „migrantischen Aufsteigermännlichkeit“ Entsprechung, die die „eigene Leistungsfähigkeit als Kernelement hegemonialer Männlichkeit“ (Seeliger, 2021, S. 126) herausstellt. Konkreter lassen sich laut Seeliger (2021, S. 127 ff.) auf drei Ebenen Berührungspunkte zwischen Gangsta-Rap und einem neoliberalen Ideal finden:
Auf einer der Hip-Hop-Kultur inhärenten Ebene ist an die genretypische Fokussierung auf den Rapper/ die Rap-Persona und seine individualistische Haltung zu denken sowie an den allgegenwärtigen Wettbewerbscharakter in der Hip-Hop-Kultur, der in sog. Battles (Wettstreit von Rapper, Breakdancern, DJs und Graffiti-Malern) und Beefs (oft öffentlich ausgetragene Konflikte) Ausdruck findet.
Die zweite Ebene betrifft die im Rap allgegenwärtige Figur des Hustlers. Das englische Wort „to hustle“ meint im ursprünglichen Sinne drängen/ drängeln. Im englisch- wie auch im deutschsprachigen Rap steht das Wort jedoch auch für kleinkriminelle Umtriebe. Rose (2008, S. 227, Hervorhebung im Original) beschreibt den Hustler wie folgt:
The glamour associated with hustling as a form of economic success increased during this period and has become a nearly completely legitimated standard in hip hop. Being a hustler is the central model of success. Hip hop rhetoric presumes that the ‘normal’ mode of success (schooling, hard work, and talent provide opportunity and upward mobility), as a model for ‘getting out of the ghetto,’ is completely cut off for black youth. Independent, most likely illegal, entrepreneurial activity is the only way. Being a hustler isn’t just a model of hard work outside legitimate avenues. It is also a model of profitable dishonesty. A hustler takes advantage of his ‘buyer’ and profits from doing so. A hustler represents a dog-eat-dog model of capitalism for the excluded.
Der Hustler ist demnach ein Unternehmer, der ein Modell der gewinnbringenden Unredlichkeit pflegt. Seine illegalen und illegitimen Aktivitäten erscheinen alternativlos, da ihm ein Zugang zu legalen Wegen des Erwerbsgewinns versperrt sind. Um seiner prekären Lebenslage zu entkommen, setzt er sich gegen alle Widerstände durch. Diese „Ellenbogen-Mentalität“ ist Ausdruck eines Haifisch-KapitalismusÖkonomisches und gesellschaftliches System, in dem Produktionsmittel in Privatbesitz sind und der Markt die Verteilung der Ressourcen regelt., der das gemeinsame Wertesystem von Gangsta-Rap und Neoliberalismus markiert und das in „Materialismus, Individualismus, Konkurrenzaffinität, körperliche Selbstoptimierung, Entrepreneurmentalität und de[n] Glaube[n] an Leistungsgerechtigkeit“ Ausdruck findet (Seeliger, 2021, S. 128).
Die dritte Ebene, die laut Seeliger (ebd.) Parallelen zwischen Gangsta-Rap und neoliberaler Alltagskultur erkennen lassen, liegt in einer kulturindustrielle Vermarktungslogik begründet. Stärker als dies bei Künstlerinnen und Künstlern aus anderen Musikgenres der Fall ist, betreiben Gangsta-Rapper eine intensive Selbstvermarktung. Die Rap-Persona wird auch außerhalb des „Kerngeschäfts“ gepflegt und auf Social Media Plattformen präsentiert. Zudem treten viele Rapper als Markenbotschafter in Erscheinung und werben für zahlreiche Firmen und Produkte oder geben eigene Modelinien heraus.
Aus der hier skizzierten Perspektive steht die Polizei dem sozialen Aufstieg entgegen. Die Polizei ist Stellvertreterin eines Staats, der das Versprechen von Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit nicht einlösen kann. Die Polizei ist aber nicht nur Sinnbild für eine strukturelle Benachteiligung und soziale Ungerechtigkeit, sondern unmittelbar vor Ort greif- und erfahrbare Instanz, die die kriminellen Aktivitäten der „Hustler“ zu unterbinden versucht. Die Gegenwart der Polizei stellt somit schlicht ein unternehmerisches Risiko dar, das es zu vermeiden gilt.
3. ACAB als Popkultur
Das dritte und letzte hier zu erörternde Motiv für eine polizeikritische oder teilweise auch polizeiablehnende Haltung im Gangsta-Rap ist vergleichsweise banal: „ACAB ist Popkultur“ (Niessen, 2017). Dieses Motiv ist weder auf das Musikgenre Gangsta-Rap beschränkt noch ein grundlegend neues Phänomen. Jugendliche Popkultur erfüllte und erfüllt immer auch den Zweck, sich gegen andere Peers, aber auch die Welt der Erwachsenen abzugrenzen und sich gegen Autoritäten aufzulehnen. In den 1950er und 1960er Jahren reichte es hierzu aus, eine Jeanshose zu tragen und englischsprachige Musik zu hören. In den 1970er und 1980er Jahren waren es vor allem Punks und Skinheads, die das bürgerliche Establishment erzürnten. In den 1990er und frühen 2000er Jahren mussten Jugendliche die Nacht zum Tag machen und in stillgelegten Industrieanlagen – als solche ehemals Orte der erwachsenen Erwerbstätigen und Produktivität – zu Technomusik feiern, um den Unmut ihrer Eltern zu erregen. Die sog. Generation Z (gemeint sind hier die Jahrgänge 1997–2012), der vermutlich die Mehrheit der Hörerschaft deutschsprachiger Rap-Musik entstammt, hat es hier schwieriger. Die neoliberale Alltagskultur (s.o.) hat auch die Kinder- und Jugendzimmer erreicht. Junge Menschen sind mit der Selbstoptimierung beschäftigt, rauchen kaum noch, trinken weniger Alkohol als dies in vorangegangenen Generationen der Fall war (vgl. Orth & Merkel, 2022) und verzichten (teilweise auch unfreiwillig aufgrund der Maßnahmen während der Corona-Pandemie) auf das Ausgehen und Feiern. Das Aufbegehren gegen Autoritäten fällt aber auch schwerer, wenn die Eltern- und Lehrergeneration selbst bereits alle Protestformen in ihrer eigenen Jugend durchgespielt hat. Wenn die Klassenlehrerin ein Lippen-Piercing trägt, der Bankberater im Sommer seine tätowierten Unterarme zeigt und die eigenen Eltern Cannabispflanzen auf der Terrasse kultivieren, bleibt wenig Spielraum für widerständiges, jugendliches Verhalten.
Die Polizei in Deutschland genießt in der Bevölkerung ein hohes Maß an Vertrauen. Achtzig Prozent der Befragten geben an, der Polizei in Deutschland (eher) zu vertrauen (Eurobarometer, 2020/2021). Der in der Weimarer RepublikDie Weimarer Republik bezeichnet die erste demokratische Staatsform in Deutschland, die von 1918 bis 1933 bestand. anlässlich einer Polizeiausstellung in Berlin 1926 geprägte Slogan „Die Polizei, Dein Freund und Helfer“ (vgl. Behr, 2000) ist bis heute den meisten Menschen geläufig, obwohl er bereits seit vielen Jahrzehnten von modernen Leitbildern abgelöst wurde. Viele Kinder bekommen von frühester Jugend an eingebläut, sich an die nächstbesten Polizisten zu wenden, wenn im Krisenfall die eigenen Eltern nicht zu erreichen sind. Wenn sich Rapper also negativ über die Polizei auslassen und Polizistinnen und Polizisten pauschal als Bastarde beschimpfen (A.C.A.B. = All Cops Are Bastards), ist dies zunächst einmal als ultimative Grenzüberschreitung zu verstehen. Das allgemein als Gute betrachtete, wird zum Feindbild umgedeutet. Würde man polizeikritische Äußerungen jetzt jedoch ausschließlich einem jugendlichen Rebellentum zuschreiben, wäre dies eine nicht hinreichende Erklärung. Wie bereits ausgeführt, spielt die Skandalisierung von polizeilichem Fehlverhalten eine wichtige Rolle im (Gangsta-)Rap. Die Beleidigung von Polizistinnen und Polizisten erfolgt also nicht in allen Fällen unreflektiert und grundlos, sondern muss in einigen Fällen durchaus als – in ihrer generalisierenden Weise wenig faire, aber im Grundsatz ernstzunehmende Beschwerde verstanden werden. Diese Perspektive findet sich auch in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wieder. Die Verfassungsrichter hatten zu entscheiden, ob durch ein Transparent mit der Aufschrift „ACAB“ das Grundrecht der Meinungsfreiheit ausgeübt wurde oder es sich um eine strafbare Beleidigung nach § 184 StGB handelt. Die Verfassungsrichter gaben zu bedenken, dass „die Parole ‚ACAB‘ [..] nicht von vornherein offensichtlich inhaltlos [sei], sondern […] eine allgemeine Ablehnung der Polizei und ein Abgrenzungsbedürfnis gegenüber der staatlichen Ordnungsmacht zum Ausdruck [brächte].“ Demzufolge würde es „sich um eine Meinungsäußerung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG [handeln und] die strafrechtlichen Verurteilungen der Beschwerdeführer [griffen] in dieses Grundrecht ein“ (Bundesverfassungsgericht, 2016). Die Parole würde, so die Verfassungsrichter weiter, den Unwert eines Kollektivs adressieren und in dem zu beurteilenden Fall keine „personalisierende[…] Adressierung“ (ebd.) erkennen lassen. Die Parole „ACAB“ stellt demnach keine Beleidigung im strafrechtlichen Sinne dar, wenn sie nicht an einzelne auszumachende Personen gerichtet wird. Der popkulturelle Charakter des Slogans wird dadurch unterstrichen, dass die vier Buchstaben bzw. der korrespondierende Zahlencode 1312 längst T-Shirts, Socken, Poster, Schlüsselanhänger usf. ziert. Auch zahlreiche Verballhornungen existieren wie etwa „All Cats Are Beautiful“, „All Clouds Are Beautiful“, „All Cops Are Beautiful“. Letztgenanntes Wortspiel wurde von Bundespolizei selbst aufgegriffen. Die vier Buchstaben zierten ein Großplakat am Berliner Alexanderplatz, auf dem die Bundespolizei um Nachwuchs wirbt (vgl. Matthies, 2023). Wenn Rapper also die Polizei als Bastarde, Bullen, Bullenschweine usf. verunglimpfen, ist dies einerseits als politische Meinungsäußerung zu verstehen, andererseits Ausdrucke eines Zeitgeistes, in der ein Aufbegehren gegen Autoritäten gesellschaftlich weit verbreitet und längst nicht auf subversive Jugendkulturen begrenzt ist.
Polizeikritik als globale Protestkultur
Hip-Hop ist eine globale Jugendkultur, die regionale und nationale Grenzen überwindet (vgl. Klein & Friedrich, 2011, S. 85). Szenetypische Codes und Stile (wie z.B. Sprache, Kleidung, alternative Ausdruckformen wie das Tanzen oder Graffiti) werden medial verbreitet und weltweit unter den Anhängerinnen und Anhängern verstanden. Das Globale und das Lokale stehen dabei in einem fortwährenden Spannungsverhältnis. Aus einer globalen Hip-Hop-Kultur entwickeln sich differente, lokale Popkulturen, die den jeweiligen spezifischen lokalen Kontexten und Gegebenheiten angepasst werden (vgl. ebd.; siehe ausführlich: Ilan, 2015, S. 130 ff.). Einer dieser global geteilten und verstandenen szenetypischen Codes ist die Abneigung gegenüber der Polizei – ACAB ist eine global geteilte Chiffre, die keiner Erklärung bedarf. Viele Rap-Fans werden mit den polizeikritischen Liedern wie etwa „Fuck the police“ von NWA, „Sound of da Police“ von KRS-One oder „Pigs“ von Cypress Hill vertraut sein. Polizeikritische Filme wie „Athena“ (2022) oder „4 Blocks“ (2017-2019) zitieren Hip-Hop-Motive und sind für ein internationales Publikum produziert. In dem Reddit-Internetforum r/ACAB werden täglich Fälle illegaler und illegitimer Polizeigewalt und Gewalt gegen Polizisten und Polizistinnen geteilt. Die hier zu sehenden Videos scheinen überwiegend, aber keineswegs ausschließlich aus den USA zu stammen und werden von einem internationalen Publikum gesehen und kommentiert. Daher spielt es nur eine untergeordnete Rolle, ob aus französischen Banlieues, Favelas in Brasilien oder von Jugendlichen aus dem Londoner Eastend oder Berlin Neukölln berichtet wird. Sie alle eint ihre prekäre soziale und wirtschaftliche Lage und das Gefühl von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen und abgehängt zu sein.
Die Polizei ist Garant der bestehenden Gesellschaftsordnung und stellt daher das gemeinsame Feindbild dar. Gangsta- und Straßenrap erzählt Aufsteigergeschichten von einem der ihren, der es geschafft hat, den widrigen Lebensumständen zu entkommen. Jeder Fehltritt der Polizei wird gefeiert, jede Form von Gewalt gegen die Polizei erscheint legitimiert, da hier nur Gleiches mit Gleichem vergolten wird. In der Konsequenz verheißt dies für die deutsche Polizei nichts Gutes. Die Polizei ist sicht- und greifbarer Repräsentant des Staates und steht insofern als Feindbild für alle Versäumnisse und soziale Missstände. Selbst eine tadellose, skandalfreie Polizeiarbeit in Deutschland würde das Bild der Polizei nicht ändern. Polizeiliche Übergriffe gegen Rodney KingRodney King war ein Afroamerikaner, der 1991 Opfer von Polizeigewalt in Los Angeles wurde. Der Vorfall löste landesweite Proteste und die L.A. Riots 1992 aus., Eric Garner, George FloydGeorge Floyd war ein Afroamerikaner, der 2020 in Minneapolis durch Polizeigewalt starb. Sein Tod löste weltweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. oder auch Oury JallohEin Asylbewerber aus Sierra Leone, der 2005 unter ungeklärten Umständen in einer Polizeizelle in Dessau verbrannte. haben sich in das subkulturelle Gedächtnis eingebrannt und sind ebenso präsent wie die Erfahrung von Alltagsrassismen und sozialer Ungleichheit. Diese Haltung fasst der Rapper Danger Dan in seinem Lied „Das ist alles von Kunstfreiheit gedeckt“ zusammen4Das Lied selbst ist als Klavierballade und Teil eines gleichnamigen Singer-/Songwriter-Albums allerdings nicht im Untersuchungssample gelistet. Das Beispiel erscheint aber trotzdem passend, da Danger Dan Gründungsmitglied der Rap-Gruppe Antilopen Gang ist und somit fest in der deutsch-sprachigen Rap-Szene verankert ist..
Und man vertraut auch nicht auf StaatDer Staat ist ein politisches Herrschaftsgebilde mit einem legitimen Gewaltmonopol über ein bestimmtes Territorium. und Polizeiapparat
Weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat
Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war
Weil sie Oury Jalloh gefesselt und angezündet haben
Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst
Ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz
Fazit & Ausblick
Annähernd jedes vierte chartnotierte, deutschsprachige Rap-Lied erwähnt die Polizei. Die Thematisierung der Polizei fällt fast immer negativ-abwertend aus. Haben also die Gewerkschaftsvertreter der Polizei Recht, wenn sie in Gangsta-Rap einen „Brandbeschleuniger der Bandenkriminalität“ und negative Auswirkungen auf das „Aussageverhalten gegenüber der Polizei“ (Gewerkschaft der Polizei (GdP) – Bundesvorstand, 2023) vermuten? Vor dem Hintergrund der hier vorliegenden Auswertungen ist die Frage mit einem Vielleicht zu beantworten. Klar ist, dass eine negative ZuschreibungEin sozialer Prozess, bei dem bestimmten Personen oder Gruppen bestimmte Eigenschaften oder Merkmale zugeschrieben werden – oft unabhängig von deren tatsächlichem Verhalten. der Polizei mit einer klaren Haltung einhergeht, unter keinen Umständen mit der Polizei zu kooperieren. Rose attestiert die Existenz einer solchen „Culture of no-snitching“ mit Blick auf die US-amerikanische Hip-Hop-Kultur:
The expansion of the culture of no-snitching into everyday life is animated by this negative experience with the police, but it ends up empowering criminal subculture, not the community as a whole. Many poor black communities are trapped between violent and unscrupulous police and criminals. Following the criminal code of no-snitching deprives these communities of ways to protect themselves from criminals and to legitimately seek justice for crimes against law-abiding citizens. (Rose, 2008, S. 225 f.)
Eine Aussageverweigerung von Zeugen ist aus polizeilicher Sicht ein Ärgernis, das Ermittlungen erschwert und verzögert. Zudem ist Rose zuzustimmen, dass in Einzelfällen hierdurch kriminelle Akteure geschützt werden und in der Folge die GemeinschaftEine Gemeinschaft ist eine Form des sozialen Zusammenlebens, die sich durch enge persönliche Bindungen, emotionale Nähe und ein starkes Wir-Gefühl auszeichnet. Der Begriff wurde maßgeblich durch Ferdinand Tönnies geprägt, der ihn als Gegensatz zur Gesellschaft verstand. durch die ungestörten kriminellen Machenschaften benachteiligt wird. Allerdings ist einer No-Snitching-Kultur auch ein positiver Aspekt abzugewinnen. Gerade junge Menschen lassen sich durch eine autoritär auftretende Polizei in einer Verhörsituation leicht einschüchtern und zu Zeugenaussagen drängen, die sie in der Folge selbst belasten könnten. Dies gilt im besonderen Maße für Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist oder die im Umgang mit deutschen Behörden und bürokratischen Abläufen nicht vertraut sind. Junge Menschen aus einem „gutbürgerlichen“ Elternhaus, können sich vermutlich in den meisten Fällen auf den Beistand durch ihre Eltern oder einen von den Eltern engagierten Rechtsbeistand verlassen, wenn sie als Zeugen oder Beschuldigte von der Polizei befragt werden sollen. Für junge Menschen, die sich nicht auf einen elterlichen oder anwaltlichen Beistand verlassen können, stellt das No-Snitching-Gebot eine plausible Alternative dar. Im Sinne rechtsstaatlicher Prinzipien ist einer abwägenden Aussagebereitschaft insofern durchaus auch Positives abzugewinnen.
Deutlich schwieriger zu beurteilen, ist der Vorwurf, Gangsta-Rap treibe Jugendliche in die Bandenkriminalität. Dieser Annahme scheint ein naives Verständnis von Medienwirkung zugrunde zu liegen. Rezipientinnen und Rezipienten sind durchaus in der Lage, ironische Brechungen und Übertreibungen zu durchschauen. Das vermeintliche Gangstertum und der angebliche Reichtum von Gangsta-Rappern werden in Szeneforen und -magazinen durchaus kritisch diskutiert. Die Befürchtung, dass Jugendliche durch das Hören der Songtexte in die Kriminalität getrieben werden, ist vergleichbar mit der Idee, dass das Schauen von Krimis zur Zunahme echter VerbrechenEin Verbrechen ist eine besonders schwerwiegende Form rechtswidrigen Handelns, die im Strafrecht mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr bedroht ist – zugleich ist es ein sozial und historisch wandelbares Konstrukt. führt – denkbar, aber kaum belegbar und mit Blick auf die Masse der Rezipient:innen äußerst unwahrscheinlich.
In diesem Zusammenhang sind vielleicht zwei andere Fragen relevanter. Zum einen die Frage, warum sich diese Kritik auf Gangsta-Rap bezieht und nicht auf andere kriminalitätsverherrlichende und polizeikritische Musikrichtungen und zum anderen die Frage, warum sich Gangsta-Rap einer so großen Beliebtheit erfreut. Die zweite Frage beantwortet sicherlich teilweise die erste.
Fünfzig Jahre nach der Geburtsstunde des Hip-Hop in der New Yorker Bronx ist Hip-Hop DIE dominierende Jugendkultur weltweit. Obwohl auch andere Jugend- und Musikkulturen ein vergleichbares autoritätskritisches Weltbild teilen (Punk, Skins, Skater, Hippies etc.), spielen diese Jugendkulturen heute zahlenmäßig eine untergeordnete Rolle. Was aber macht Rap und insbesondere Gangsta-Rap bei der Hörerschaft so beliebt? Darüber können an dieser Stelle nur Vermutungen angestellt werden. Für eine wissenschaftlich seriöse Untersuchung müssten die Hörerinnen und Hörer selbst befragt werden. Ein Teil der Antwort könnte aber lauten: „Crime and sex sells“.
Die Faszination, die von Geschichten über Verbrechen und Verbrechensbekämpfung ausgeht, ist keineswegs auf die Musik beschränkt. Krimis und Reality-Formate im Fernsehen, die sich mit Verbrechen beschäftigen, gehören zu den beliebtesten Fernsehformaten. True-Crime-Podcasts dominieren die Podcast-Charts. Krimis und Thriller sowie Bücher von (ehemaligen) Polizisten und Rechtsmedizinern belegen regelmäßig Spitzenplätze in den Verkaufscharts. So ist es nicht verwunderlich, dass junge Hörerinnen und Hörer Gefallen an Kriminalgeschichten finden und im Jugendzimmer Gangsta-Rap hören, während die Eltern im Wohnzimmer den neuesten „Tatort“ im Fernsehen verfolgen. Eine weitere Parallele findet sich in der spezifischen Darstellung von Kriminalität und Kriminalitätskontrolle. Wie im Gangsta-Rap ist die Darstellung in Film und Fernsehen meist verzerrt und entspricht nicht der Realität. Schwere Gewaltverbrechen sind stark überrepräsentiert und die Darstellung der Polizei variiert oft zwischen inkompetent / unbeholfen (z.B. Toto & Harry, Monk) und machohaft, erlebnisorientiert und gewaltaffin (z.B. Robocop, Alarm für Cobra 11). Gangsta-Rap ist also in erster Linie ein warenförmiges Unterhaltungsprodukt, das aus der Feder von Künstlerinnen und Künstlern stammt, die sich auf ihre künstlerischen Freiheiten berufen (dürfen). Ob diese Musikprodukte als reine Unterhaltung oder als Identifikationsangebot von der Hörerschaft angesehen werden, lässt auf Grundlage der hier durchgeführten Untersuchung nicht beantworten. Auch der Wahrheitsgehalt der dargebotenen Kriminalitätsgeschichten lässt sich nur in Einzelfällen beurteilen. In Übereinstimmung mit Kubrin (2005, S. 454) ließe sich argumentieren, dass die Frage nach der „Realness“ zweitrangig ist. Vielmehr kreiert Gangsta-Rap eine „vision of urban life” (ebd.) und beeinflusst dadurch die Art und Weise wie wir prekäre Lebenslagen wahrnehmen und beurteilen.
Ergänzend wäre zu überlegen, ob es wirklich wünschenswert ist, dass Gangsta-Rap (und konsequenterweise andere autoritätskritische und devianzbejahende Äußerungen) von Jugendlichen mehrheitlich abgelehnt werden. Jugend muss widerständig sein. Eine angepasste Generation von „Ja- und Amen-Sagern“ wird nicht auf Versäumnisse in der Klima- und Umweltpolitik aufmerksam machen, wird nicht gegen rechtspopulistische Parteien auf die Straße gehen und sich vermutlich aus demokratischen Entscheidungsprozessen weitgehend heraushalten. Widerstand und Respektlosigkeit muss es geben. Dass dieses Verhalten mitunter ein nur schwer zu tolerierendes Maß erreicht oder auch gegen die Falschen gerichtet ist, ist ungerecht, liegt aber in der Natur der Sache begründet.
Mit Blick auf die Polizeidarstellung lässt sich resümieren, dass es im Gangsta-Rap nur selten um eine explizit politische, vordergründige Polizeikritik geht. Die Polizei als Inhaberin des Gewaltmonopols wird als solche in den meisten Fällen anerkannt – jedoch nicht respektiert. Die Polizei dient sehr häufig als Prügelknabe für soziale Missstände.
Hieraus ließen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten: Polizeiarbeit muss in allen Fällen vorbildlich sein. Als Rollenträger agiert jede einzelne Polizistin und jeder einzelne Polizist in Deutschland stellvertretend für die Institution der Polizei. Die Polizei wird gemessen an ihren schlechtesten Mitgliedern. Daher wird jedes nicht rechtmäßige Verhalten im Einsatz, jeder Anschein eines rassistisch motivierten Einsatzes, jeder rechtsextremistische Kommentar in polizeiinternen Chatgruppen, jeder Fall von Korruption registriert und verfestigt das Feindbild Polizei.
Da sich bei genauer Betrachtung die Polizeikritik als Sozialkritik erweist, muss geschlussfolgert werden, dass soziale Missstände angegangen und soziale Ungerechtigkeit beseitigt werden muss um das Bild der Polizei (die hier stellvertretend für den Staat angesehen werden) zu verbessern. Der Rechtswissenschaftler Franz von Liszt wusste bereits vor 150 Jahren, dass die beste KriminalpolitikStrategien und Maßnahmen staatlicher Institutionen zur Aufrechterhaltung sozialer Ordnung und zur Reaktion auf regelwidriges Verhalten. eine gute Sozialpolitik ist. Diese Weisheit bewahrheitet sich auch hier.
Literatur
- Abdul-Rahman, L.; Espín Grau, H.; Klaus, L.; Singelnstein, T. (2020). Rassismus und Diskriminierungserfahrungen im Kontext polizeilicher Gewaltausübung. Zweiter Zwischenbericht zum Forschungsprojekt „Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt*innen“ (KviAPol). https://kviapol.uni-frankfurt.de/
- Alim, H. S., Lamontagne, S., Shawel, T., Story, D., Williams, A., Douglass, M., Matus, E., Moore, L. F., Parks, S. K., Reed, T. A., & Wong, C. P. (2023). Public Enemy, Public Scholarship: Hiphopography and the Co-production of Knowledge with Chuck D. In Q. Williams & J. N. Singh (Hrsg.), Global Hiphopography (S. 29–56). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21955-9_2
- Anderson, E. (1999). Code of the Street. Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City. Norton.
- Behr, R. (2014). „Gewalt“ und „Zwang“ – Überlegungen zum Diskurs über Polizei. In H. Schmidt-Semisch & H. Hess (Hrsg.), Die Sinnprovinz der Kriminalität. Zur Dynamik eines sozialen Feldes (S. 203-218). Springer VS.
- Behr, R. (2000). Cop Culture und Polizeikultur: von den Schwierigkeiten einer Corporate Identity der Polizei, S. 14. In: K. Liebl & T. Ohlemacher (Hrsg.), Empirische Polizeiforschung. Interdisziplinäre Perspektiven in einem sich entwickelnden Forschungsfeld (S. 12-26). Centaurus-Verlag.
- Bude, H. (2008). Die Ausgeschlossenen. Das Ende vom Traum einer gerechten Gesellschaft. Hanser.
- Bude, H. & Willisch, A. (Hrsg.). (2006). Das Problem der Exklusion. Ausgegrenzte, Entbehrliche, Überflüssige. Hamburger Edition.
- Bude, H. & Willisch, A. (Hrsg.). (2008). Exklusion: die Debatte über die „Überflüssigen“. Suhrkamp.
- Bundesverfassungsgericht. (2016, 24. Juni). „Kollektivbeleidigung“ nur bei Bezug zu einer hinreichend überschaubaren und abgegrenzten Personengruppe [Pressemitteilung Nr. 36/2016]. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/bvg16-036.html
- Burzan, N. (2011). Soziale Ungleichheit. Eine Einführung in die zentralen Theorien (4. Aufl.). VS Verlag.
- Castel, R. & Dörre, K. (Hrsg.) (2009). Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Campus.
- Chassé, K. A. (2009). Unterschichten in Deutschland: Materialien zu einer kritischen Debatte. VS Verlag.
- Cohen, A. (1955). Delinquent Boys: The Culture of the Gang. Palgrave Macmillan.
- Engels, F. (1976 [1845]). Die Lage der arbeitenden Klasse in England. In K. Marx. & F. Engels. Marx-Engels-Werke, Band 2 (S. 225–506). Dietz-Verlag.
- Eurobarometer. (2020/ 2021, Winter). Standard-Eurobarometer 94. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2355
- Ferrell, J., Hayward, K., & Young, J. (2015). Cultural Criminology: An Invitation (2. Aufl.). Sage.
- Gewerkschaft der Polizei (GdP) – Bundesvorstand (2023, 27. Dezember). GdP Hamburg: Soziale Medien und Musik sind Brandbeschleuniger der Bandenkriminalität. https://www2.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/DE_GdP-Hamburg-Soziale-Medien-und-Musik-sind-Brandbeschleuniger-der-Bandenkriminalitaet?open&ccm=300045
- Gontek, F. (07.04.2024). 20 Jahre Sidos »Mein Block«. Sein Leben, fremde Welt. Spiegel Online. https://www.spiegel.de/kultur/musik/sido-20-jahre-mein-block-wie-der-track-den-strassenrap-in-deutschland-gepraegt-hat-a-e293cc58-0227-4057-a32c-90d3b670ebe4?sara_ref=re-xx-cp-sh
- Hebdige, D. (1979/2005). Subculture: The Meaning of Style. Routledge.
- Ilan, J. (2015). Understanding Street Culture. Poverty, Crime, Youth and Cool. Palgrave.
- Klein, G., & Friedrich, M. (2011). Is this real? die Kultur des HipHop (Orig.-Ausg., 4. Aufl., Issue 2315). Suhrkamp.
- Kronauer, M. (2010). Exklusion. Die Gefährdung des Sozialen im hoch entwickeltenKapitalismus (2. Aufl.). Campus.
- Kubrin, C. E. (2005). “I See Death around the Corner”: Nihilism in Rap Music. Sociological Perspectives, 48(4), 433–459. https://doi.org/10.1525/sop.2005.48.4.433
- Lütten, J. & Seeliger, M. (2017). “Rede nicht von Liebe, gib‘ mir Knete für die Miete“ Prekäre Gesellschaftsbilder im deutschen Straßen- und Gangsta-Rap. In M. Seeliger & M. Dietrich (Hrsg.). Deutscher Gangsta-Rap II. Popkultur als Kampf um Anerkennung und Integration (S. 89-104). transcript.
- Mahoney, E. (2012). The Black CNN – When Hip Hop Took Control. The Guardian. https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2010/jun/25/black-cnn-hip-hop-took-control
- Manske, A. & Pühl, K. (Hrsg.). (2010). Prekarisierung zwischen Anomie und Normalisierung: Geschlechtertheoretische Bestimmungen. Westfälisches Dampfboot.
- Mason, C. E. (2012, 13. August). Jay-Z’s 99 Problems, Verse 2: A Close Reading with Fourth Amendment Guidance for Cops and Perps. St. Louis University Law Journal, 56 (567), 567-587.
- Matthies, B. (2023, 18. Januar). Alles schön?!: Bundespolizei wirbt mit „ACAB“-Plakaten am Berliner Alexanderplatz. Tagesspiegel. https://www.tagesspiegel.de/berlin/alles-schon-bundespolizei-wirbt-mit-acab-plakaten-am-berliner-alexanderplatz-9204465.html
- Miller, W. (1958). ‘Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency’. Journal of Social Issues, 14(3), S. 5-19.
- Niemz, J. & Singelnstein, T. (2022). Racial Profiling als polizeiliche Praxis. In: Hunold, D., Singelnstein, T. (Hrsg.), Rassismus in der Polizei. Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37133-3_16
- Niessen, B. (2017, August 22). “Niemand will Bulle sein” – Ist der Polizeiberuf zu unattraktiv? VICE. https://www.vice.com/de/article/nee3yx/niemand-will-bulle-sein-ist-der-polizeiberuf-zu-unattraktiv
- Orth, B. & Merkel, C. (2022). Der Substanzkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland. Ergebnisse des Alkoholsurveys 2021 zu Alkohol, Rauchen, Cannabis und Trends. BZgA-Forschungsbericht. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. https://doi.org/10.17623/BZGA:Q3-ALKSY21-DE-1.0
- Park, R., Burgees, E. & McKenzie, R. (1925). The City: Suggestions for Investigation of Human Behaviour in the Urban Environment. University of Chicago Press.
- Rinn, M., Wehrheim, J. & Wiese, L. (2020). Kein Einzelfall. Über den Tod von Adel B., der während eines Polizeieinsatzes in Essen-Altendorf erschossen wurde. Sub\Urban Zeitschrift für Kritische Stadtforschung, 8(1/2), 263–276. https://doi.org/10.36900/suburban.v8i1/2.556
- Rose, T. (2008). The hip hop wars: what we talk about when we talk about hip hop–and why it matters. BasicCivitas.
- Seeliger, M. (2021). Soziologie des Gangstarap. Popkultur als Ausdruck sozialer Konflikte. Beltz Juventa.
- Seeliger, M. & Sahr, A. (2022). Pokerspiele in der Ghettoökonomie. Zur symbolischen Repräsentation von Ungleichheit durch monetäre Topoi im deutschen Gangstarap. In M. Dietrich & M. Seeliger (Hrsg.), Deutscher Gangsta-Rap III. Soziale Konflikte und kulturelle Repräsentationen (S. 271-299). transcript.
- Shaw, C. & McKay, H. (1942). Juvenile Delinquency and Urban Areas. University of Chicago Press.
- Sykes, G. M. & Matza, D. (1968). Techniken der Neutralisierung. Eine Theorie der Delinquenz. In F. Sack & R. König (Hrsg.), Kriminalsoziologie. Akademische Verlagsgesellschaft.
- Vogel, B. (2008). Prekarität und Prekariat – Signalwörter neuer sozialer Ungleichheiten. Aus Politik und Zeitgeschichte. Nr. 33 / 11.08.2008 – Thema: Abstieg – Prekarität – Ausgrenzung. Bundeszentrale für politische Bildung.
- Whyte, W. (1943). Street Corner Society. University of Chicago Press.
- Wickert, C. (2018). “Ich hab’’ Polizei“ – Die Darstellung der Polizei in deutschsprachigen Rapliedern.” In A. Mensching & A. Jacobsen (Hrsg.), Empirische Polizeiforschung XXI: Polizei im Spannungsfeld von Autorität, Legitimität und Kompetenz (Issue Band 24, S. 163–183). Verlag für Polizeiwissenschaft, Prof. Dr. Clemens Lorei.
- Young, J. (1999). The Exclusive Society, Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity. Sage.
Fußnoten
- 1Dies zeigt sich beispielsweise an dem Wechsel der Erzählperspektive vom „Ich“ hin zum „Wir“, womit der Erzähler signalisiert, dass seine persönlichen Erfahrungen auch von seiner Hörerschaft gemacht wurden (vgl. Wickert, 2018).
- 2In seinem Lied CopKKKilla (2015) rappt Haftbefehl: „Und fünf von zehn Polizisten Hurensöhne“ verallgemeinert aber anderer Stelle und sagt: „Die Rauschgiftfahndung ist korrupt, so wie der Zoll“.
- 3Für einen Überblick siehe: Ilan, 2015, S. 22 ff.
- 4Das Lied selbst ist als Klavierballade und Teil eines gleichnamigen Singer-/Songwriter-Albums allerdings nicht im Untersuchungssample gelistet. Das Beispiel erscheint aber trotzdem passend, da Danger Dan Gründungsmitglied der Rap-Gruppe Antilopen Gang ist und somit fest in der deutsch-sprachigen Rap-Szene verankert ist.