Der Beitrag analysiert die Darstellung kriminellen Verhaltens – insbesondere des Drogenhandels – im deutschsprachigen Rap und beleuchtet, wie soziale Herkunft, psychische Belastung und das Frauenbild im Kontext von Street Credibility inszeniert werden.
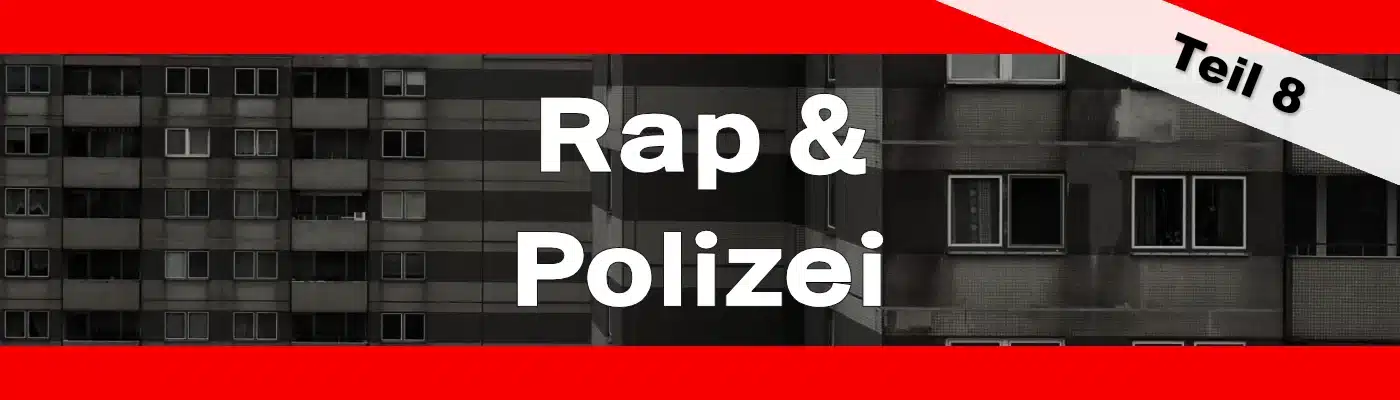
Deviantes Verhalten
Wie in den vorangegangenen Ausführungen bereits dargelegt, ist die Darstellung des eigenen kriminellen Verhaltens ein zentrales Element im Gangsta-Rap. Hierbei dominiert der Schmuggel und Verkauf von Drogen (s.u). Eine untergeordnete Rolle spielen GewaltGewalt bezeichnet die absichtliche Anwendung körperlicher oder psychischer Kraft zur Schädigung von Personen oder Dingen.- und Eigentumsdelikte. Bei dem Thema Gewalt existiert eine Parallele zur Forschungsarbeit von Kubrin (2005a), die feststellt:
On the streets, the image one projects is paramount, and at the top of the hierarchy is the ‘crazy,’ ‘wild,’ or ‘killer’ social identity (Wilkinson 2001:246). A person’s public bearing must send the message that he or she is capable of violence when necessary. (S. 363)
Die Demonstration der körperlichen Überlegenheit sichert die eigene Unversehrtheit und bekommt somit einen präventiven Charakter. In diesem Kontext sind auch die Codes „Waffen“ und „GefängnisDas Gefängnis ist eine staatliche Institution des Freiheitsentzugs, die als zentrale Sanktionsform moderner Strafrechtssysteme dient.“ zu verstehen. Die Aussage von Gangsta-Rappern, über Hafterfahrung zu verfügen, im Besitz scharfer Waffen und Mitglied einer kriminellen Gruppe zu sein, ist auch als Warnung an andere zu verstehen und bestärkt die eigene Reputation. Im Untersuchungssample sticht insbesondere der Rapper AK Ausserkontrolle hervor. Der Berliner Rapper kurdischer Herkunft ist vorgebliches Mitglied der sog. Gullideckelbande, die für eine Reihe von spektakulären Einbrüchen verantwortlich gemacht wird (vgl. B.Z., 2015). Der Name bezieht sich auf den Modus Operandi, bei dem Gullideckel oder andere schwere Objekte genutzt werden, um sich Zugang zu einem Objekt zu verschaffen. AK Ausserkontrolle tritt in der Öffentlichkeit stets vermummt auf und bezieht sich in seinen Liedtexten immer wieder seine kriminelle Karriere wie die nachfolgenden drei Beispiele verdeutlichen.
Starte Blitzraub, Straße blitzt blau
Öfter Türen aufgehebelt als auf Bühnen aufgetreten
Einbruch, Raub, rein und raus
Kameras zeichnen auf mit Zeitverlauf
Anklage abgelehnt, Staatsanwalt platzt
Lächeln auf der Anklagebank
Alles geplant, zwanzig Riesen, gib mei’m Anwalt auf Hand
Und geh‘ am selben Abend durch die Wand in die Bank
Aber auch andere Rapper berichten von kriminellen Handlungen. 18 Karat weiß zu berichten, er trage „Immer Revolver mit unter dem Pulli“ (18 Karat, 2021, FamilieFamilie bezeichnet eine soziale Institution, in der Verwandtschafts-, Sorge- und Intimitätsbeziehungen organisiert sind und zentrale Prozesse der Sozialisation stattfinden.), Al-Gear droht „Ey, ich komm‘ mit Dreckskanaken nachts zu dir / Die schwerbewaffnet und maskiert / Auf leeren Taschen und Hartz IV perverse Sachen praktizier’n“ (2018, Meine-Welt) und Schwesta Ewa rappt „Q6, stürmen die Zentralbank“ (2018, Schnelles Geld). Das mit Abstand häufigste Delikt, von dem in Liedtexten berichtet wird, ist jedoch das Drogendealen.
DrogenDrogen sind psychoaktive Substanzen, die das zentrale Nervensystem beeinflussen und in legaler oder illegaler Form konsumiert werden. / Drogenhandel
Das Thema „Drogen/ Drogenhandel“ im deutschsprachigen Rap erweist sich als äußerst vielschichtig und komplex. Aussagen über das Dealen aber auch den Konsum von Drogen finden sich bei zahlreichen Rappern. Thematisiert werden sowohl legale Drogen wie Alkohol, Tabak und Glücksspiel/ Sportwetten, aber v.a. auch illegalisierte Drogen (CannabisCannabis ist eine psychoaktive Substanz, die aus den Blüten und Harzen der Hanfpflanze (Cannabis sativa, Cannabis indica) gewonnen wird. Es zählt zu den am weitesten verbreiteten illegalen Drogen weltweit., Kokain, Crack, Amphetamine, Ecstasy, Opiate usw.) und der Konsum verschreibungspflichtiger Medikamente (z.B. Codein, Benzodiazepin). Dabei finden zahlreiche Slangbegriffe für die unterschiedlichen Substanzen Verwendung. In der folgenden Übersicht finden sich die üblichsten Begriffe wieder:
Eine detaillierte quantitative Auswertung, welche Droge am häufigsten benannt wurde, hätte den Rahmen des Projekts gesprengt. Jedoch lässt sich sagen, dass Cannabis mit ca. 4.500 Wortnennungen am häufigsten thematisiert wird – gefolgt von Kokain mit ca. 1.700 Wortnennungen. Darüber hinaus ist die Vielzahl der Nennung von verschreibungspflichtigen Medikamenten aufschlussreich. Jugend- und Partykultur ist üblicherweise mit aufputschenden und enthemmenden Drogen assoziiert (wie z.B. AlkoholEine psychoaktive Substanz, die als Genussmittel konsumiert wird und durch ihre berauschende Wirkung bekannt ist. Chemisch handelt es sich um Ethanol (C₂H₅OH)., Kokain, Speed, Ecstasy), die ein ausdauerndes und ausgelassenes Feiern erlauben. Bei vielen in Tabelle 1 benannten Substanzen handelt es sich hingegen um Drogen mit einer stark sedierenden Wirkung (z.B. aus der Gruppe der Benzodiazepine oder auch opiathaltige Arzneimittel). Dies lässt die Vermutung zu, dass hier die betäubende und abstumpfende Wirkung erwünscht wird. Ein Zusammenhang zu den Auswertungskategorien „soziale Lage“ und „psychische Probleme“ liegt hier nahe. Dieser Zusammenhang wird in dem nachstehenden Liedtextzitat des Schweizer Rappers Monet192 deutlich.
Liebe schmeckt hier nach Metall und Jack Daniel’s
Wir alle träumen groß, schlafen nur mit Xanax
’ne Milli aufm Schoß, Bruder, wird es hässlich
Geh und frag die Dawgs, jeder will hier raus
Doch da, wo du herkommst, suchst du’s dir nicht aus
Willst du das mit mir teil’n oder ist’s zu viel?
Baby, das‘ kein Film, das ist Reality
Im Kontext der Darstellung der PolizeiDie Polizei ist eine staatliche Institution zur Gefahrenabwehr, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Verfolgung von Straftaten. spielen Drogen vor allem im Kontext des vorgeblichen illegalen Handels mit Cannabis und Kokain eine Rolle. Der Hamburger Rapper LX zeigt sich diesbezüglich flexibel:
Ich bring‘ Stoff, ich verpack’s, egal, ob Ot oder Natz
Andere illegale wie legale Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente finden häufig Erwähnung jedoch seltener im Kontext des illegalen Drogenhandels. Der angebliche Drogenschmuggel und -handel findet länderübergreifend und im großen Umfang statt. Der wegen Drogenhandels verurteilte Rapper 18 Karat weiß beispielsweise zu berichten:
Brauch‘ keine Grammwaage, Kilos in der Wand stapeln (Pusher)
Schiebe über Ländergrenzen vakuumiert im Pannenwagen
Aber auch der Straßenhandel kleinere Mengen wird regelmäßig thematisiert, wie z.B. vom Rapper NGEE, der seiner Hörerschaft auch Hinweise liefert, wie man beim Drogenhandel unentdeckt bleibt:
Baba Schnee in den Päckchen drin
Ganzen Tag von A nach B, seit ich sechzehn bin
Besser lass dein Handy im Auto bei der Warenübergabe
Vielleicht interessanter als der Umstand, dass Drogenhandel im Kontext des deutschsprachigen Gangsta-Raps vielfach Erwähnung findet, ist die Frage, weshalb es gerade der Drogenhandel ist, der als illegales Beschäftigungsfeld gewählt wird. Der illegale Drogenhandel verspricht einerseits große Gewinnspannen und setzt keine besonderen Qualifikationen voraus. Eine Bezugsquelle und ein potentieller Käuferkreis vorausgesetzt, eröffnet sich jedem die Gelegenheit, mit Drogen zu handeln. Der Ökonom Steven Levitt rechnet mit Blick auf US-amerikanische Crack-Dealer allerdings vor, dass für die Mehrzahl der Drogendealer das illegale Drogengeschäft weit weniger einträglich ist, als es zunächst den Anschein haben mag. Der durchschnittliche Verdienst läge, so Levitt (2004), unter dem Mindestlohn. Im Gegensatz zum Drogenhandel setzt z.B. Wirtschaftskriminalität oder auch der KfZ-Diebstahl oder der Wohnungseinbruchsdiebstahl ein profundes Wissen und praktische Erfahrungen voraus.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von embed.ted.com zu laden.
Kubrin (2005a) erklärt die Dominanz des illegalen Drogenhandels im Gangsta-Rap zum einen mit der Gelegenheitsstruktur. Die Gelegenheit zum Drogendealen läge „literally just around the corner“ (S. 362). Im Einklang mit kriminologischen Drucktheorien erklärt die Autorin weiter, dass in Ermangelung legitimer Möglichkeiten einer ökonomisch und sozial erfolgreichen Lebensführung sich der Drogenhandel als „one of the most viable ‚job‘ options in the face of limited employment opportunities“ darstelle (ebd.). Diese Erklärung erscheint auch mit Blick auf das hier zugrunde liegende Sample deutschsprachiger Lieder plausibel. Das Argument wird deutlicher, wenn man die analysierten Textstellen betrachtet, die den Codes „Ort“ und „Soziale Lage“ zugewiesen wurden.
Ort/ sozialer Raum

ChJ95, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Die Kategorie „Ort“ betrifft über siebenhundert Textstellen, die auf konkrete Orte wie z.B. Deutschland, Hamburg, Schöneberg usw. oder unspezifischen Ortsangaben wie z.B. Ghetto, Block, Viertel usw. verweisen. Der Ort spielt sowohl im Kontext der Authentizität, psychischer Probleme als auch in Bezug zur Polizei eine wichtige RolleEine soziale Rolle bezeichnet das Bündel normativer Erwartungen, das an das Verhalten einer Person in einer bestimmten sozialen Position geknüpft ist.. Viele der benannten Örtlichkeiten – unabhängig davon, ob es sich hier um konkrete oder unspezifische Orte handelt – verweisen auf eine soziale Desorganisation. Die benannten Orte werden oftmals charakterisiert als strukturschwache, segregierte Wohnorte und Kriminalitätsbrennpunkte. Der Essener Rapper Veysel weiß z.B. über seine Heimatstadt zu berichten:
Altendorfer Straße, Elm Street
Meine Gegend, sie leuchtet blau
Wieder Kripos vor meiner Haustür
Hör‘ die Schritte im Treppenhaus
Neben dem Vergleich der Altendorfer Straße, die bundesweit durch Drogen- und GewaltkriminalitätUnter Gewaltkriminalität werden Straftaten verstanden, bei denen physische Gewalt gegen Personen angewendet oder angedroht wird. immer wieder in die Schlagzeilen geraten ist, mit der Elm Street aus der Horrorfilmreihe „A Nightmare on Elm Street“ (Wes Craven, 1984) ist auffällig, dass der Ort durch die Anwesenheit der Polizei charakterisiert wird. Durch die zweimalige Verwendung des Possessivpronomens „mein“ („meine Gegend“, „vor meiner Haustür“) bringt der Sprecher gleichsam zum Ausdruck, dass er sich diese – einem Horrorfilm gleichende, kriminalitätsbelastete – Umwelt zu eigen macht und sich in ihr zu behaupten weiß. Dieser Zusammenhang zwischen den in der Untersuchung als Kategorien „Ort“, „Authentizität“ und „Polizei“ identifizierten Aussagen, lassen sich in vielen Liedern finden. Der Ort wird durch die Anwesenheit der Polizei als gefährlich charakterisiert. Die Polizei fungiert demnach hier nicht als Garant für SicherheitSicherheit bezeichnet den gesellschaftlich hergestellten Zustand der Abwesenheit oder Beherrschbarkeit von Gefahren., sondern als Indikator für eine soziale Desorganisation. Zugleich verweist diese Charakterisierung des Ortes auf Herkunft des lyrischen Ichs, das seinen sozialen Nahraum als ‚gefährlichen Ort‘ kennzeichnet. Dies bestärkt wiederum die Authentizität der Rap-Persona zumal, wenn ein konkreter Ort benannt wird. Die folgenden drei Beispiele stehen exemplarisch für eine große Anzahl ähnlicher Textpassagen.
Scheißen auf Regeln, treten auf Police, *pfuh*
24 Stunden Herzrasen, helle Jeans
Das Alpha-Zeichen umgekehrt tragen
Emmertsgrundpassage, fick deine Grammy-Welt
Unsere Lederjacken riechen nach Gefängniszell’n
Scheiß auf den Pass, im Herzen noch Asyl
Block sieben, Phantombilder in den Fahrstühlen
Blaulicht zirkuliert in meiner Nachbarschaft
Ich sag‘ Prost für mein’n Block, fick auf SOKO und Cops
Auffällig ist auch ein Zusammenhang zwischen der Darstellung des Ortes und einer geschilderten psychischen Belastung. Hier finden sich Textpassagen, die den drei folgenden ähneln:
Bulle lässt keine Luft in der Hood, muss chill’n
Köpfe kaputt, doch bleib‘ effizient
Paranoias, wenn der Kripo rennt
Guck, hier siehst du Bullen, die Kanaken schikanieren
Weil der goldene Adler ihren roten Pass nicht verziert
Hier verblassen deine Träume wegen Mindestlöhnen, Andophyne
Du hörst von den Hinterhöfen Mandolinen, das ist Neukölln
Du siehst hier keinen, der auf Abireise war
Der Ort steht hier stellvertretend für eine empfundene Perspektivlosigkeit. In Übereinstimmung mit kriminologischen Drucktheorien wird in zahlreichen Liedtexten im Untersuchungssample unterstellt, dass legale Möglichkeiten des sozialen und wirtschaftlichen Aufstiegs den Akteuren verstellt sind. Ein sozialer Aufstieg und gesellschaftliche Teilhabe sollen durch illegale Aktivitäten (und hier insbesondere der Drogenhandel) erreicht werden. Die Polizei steht diesem möglichen Ausweg aus dem „Ghetto“ 1Der im Deutschrap viel verwendete Begriff Ghetto lässt klare Parallelen zum US-amerikanischen Rap erkennen, in dem Rapper von ihrer Herkunft aus den „Projects“ (gemeint sind: housing projects = Sozialbau-/ Hochhaussiedlungen) berichten. Diese Gleichsetzung der Wohnsituation ist aus einer stadtsoziologischen Perspektive nicht haltbar. Häussermann und Kronauer (2009) schreiben hierzu: „Zwar gibt es in deutschen Städten bisher keine Parallele zu den Gettos der Schwarzen, bei denen sich die Härte der Ausgrenzung aus rassistischer DiskriminierungDiskriminierung beschreibt die Benachteiligung oder Herabsetzung von Personen oder Gruppen aufgrund bestimmter Merkmale wie Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Religion oder sozialem Status., fehlenden sozialstaatliche Sicherungen und strikt marktförmigem Wohnungssystem ergibt, aber ähnliche Auswirkungen der sozialräumlichen Ausgrenzung sind auch in unseren Städten zu beobachten beziehungsweise zu befürchten.“ (S. 120). Die Autoren spielen hier auf den Einfluss des Wohngebietes auf Verhalten, Normen und Lebensrisiken und -chancen an. entgegen. Die soziale Lage an sich und der polizeiliche Verfolgungsdruck verursachen eine psychische Belastung. Die Kategorie „psychische Belastung“ lässt Parallelen zu einer qualitativen Untersuchung von über sechshundert US-amerikanischen Rap-Liedern hinsichtlich einer Perspektivlosigkeit/ Nihilismus erkennen (Kubrin, 2005b). Die Autorin sieht eine nihilistische Haltung in Rap-Liedern im Zusammenhang mit (1.) einer trostlosen Lebensumwelt und Hoffnungslosigkeit verbunden (bleak surroundings with little hope), (2.) in einem Zusammenhang mit der allgegenwärtigen Gewalt im Ghetto (pervasive violence in the ghetto) sowie (3.) einer Beschäftigung mit Tod und Sterben (preoccupation with death and dying) (vgl. ebd., S. 444 ff.). Kubrin (ebd., S. 453) weist darauf hin, dass Gewalt und die Beschäftigung mit Tod nicht ausschließlich als kulturelle Eigenart des Gangsta-Rap betrachtet werden kann, sondern auch strukturelle Faktoren, die die Lebensumstände der Rapper beeinflussen, zur Erklärung herangezogen werden müssen. Mit Verweis auf Andersons Arbeit zum „Code of the Street“ (1999) (und in Übereinstimmung der Ergebnisse der hier vorliegenden Untersuchung) nennt sie das Fehlen von Arbeitsplätzen mit existenzsichernden Löhnen, die eingeschränkte öffentliche Grundversorgung (Polizeieinsätze in Notfällen, Gebäudeinstandhaltung, Müllabfuhr, Beleuchtung und andere Dienstleistungen, die in den Vierteln der Mittelschicht als selbstverständlich angesehen werden), das Stigma der ethnischen Zugehörigkeit, die Folgen von Drogenkonsum und -handel und die daraus resultierende Entfremdung und das Fehlen von Hoffnung für die Zukunft.
Soziale Lage, Luxus und Frauenbild
Aussagen zur sozialen Lage im Untersuchungssample finden wie oben ausgeführt insbesondere im Kontext von Ort und psychischer Belastung statt. Auffällig ist, dass klassische Bildungsbiographien keinen Raum in der Selbstdarstellung der Straßenrapper finden. Stattdessen werden wie von Dollinger und Rieger (2023) treffend beschreiben Schilderungen verbreitet, nach denen sich der Rapper aus eigener Kraft und gegen zahlreiche Widerstände (gegen Polizei, GesellschaftEine Gesellschaft ist ein strukturiertes Gefüge von Menschen, die innerhalb eines geografischen Raumes unter gemeinsamen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen leben und durch institutionalisierte soziale Beziehungen miteinander verbunden sind., andere Rapper usw.) aus seiner als prekär empfundenen Lage befreit hat. Der ukrainisch-stämmige Rapper Olexesh rappt beispielsweise:
Damals auf Hartz IV, man, jetzt wohn‘ ich im Apartment
Sieh mein Geld will aus der Tasche und die Woddis wollen poppen
Dabei verweisen diese Selbstermächtigungsphantasien auch auf den Ursprung der Hip-Hop-KulturKultur bezeichnet die Gesamtheit gemeinsamer Bedeutungen, Symbole, Praktiken und Lebensweisen einer Gesellschaft oder Gruppe. in den 1970er Jahren in der New Yorker Bronx. Von Beginn an schwang „im Rap immer auch die Idee mit, es von der Straße ganz nach oben schaffen zu wollen. Die Sozialkritik im Rap trug immer den Moment sozialer Selbstermächtigung in sich.“ (Gontek, 2024). Sehr deutlich wird dieser Wunsch des sozialen Aufstiegs in dem Liedtext Blatt Papier des türkischstämmigen Kölner Rappers Eko Fresh. In einer Art Anti-Gangsta-RapSubgenre des Hip-Hop, das Gewalt, Straßenerfahrung, Macht und Marginalisierung thematisiert. Lied beschreibt er Musik als seine gewählte Selbstermächtigungsstrategie.
Es ist nicht fair: warum wird der eine reich geboren?
Und der andere wird von der Polizei gestalkt?
Am Mic performen aus der Parallelgesellschaft
Wo man Para oder Geld macht und haram hält dich hellwach
Ich wollte nie die Pumpgun unterm Kopfkissen
Ich wollte immer nur die Punchlines in mein Block kritzeln
Während sie Ot tickten, schreibt’ ich es auf
Sie planten einen Bruch und sagten: „Bleib ma’ zuhaus!“
Sie wussten, dass vielleicht etwas aus mir wird
Es gab zwei Varianten: Rapper oder stirb
Was sollte auch sonst aus mir werden? Ich weiß nicht!
Schule verkackt – ich lernte den Scheiß nicht
Entweder ich sitz’ fertig am Schreibtisch
Tag’ Verse mit Bleistift oder sterbe mit 30
Was war der Weg, dass man erzählt
Es reicht wenn du auf der Bühne meinen Namen erwähnst
Als Beleg für den erfolgreichen Ausbruch aus der sozialen Randständigkeit dienen Luxusgüter und materielle Statussymbole. Im Untersuchungssample konnten über vierhundert Textstellen codiert werden, in denen Luxusautos, -uhren, -hotels usw. erwähnt werden. Dabei kommt nicht allen Luxusgütern und -marken die gleiche Bedeutung zu. Die Düsseldorfer Beratungsfirma The Ambition veröffentlicht jährlich ihren „Ambition Score“ (The Ambition GmbH, 2024), der Aufschluss über die Bekanntheit von Marken, ihre Glaubwürdigkeit gibt und inwieweit Marken mit der Hip-Hop-Kultur assoziiert werden. Eine detaillierte Analyse, welche Luxusgüter und -marken die meisten Wortnennungen auf sich vereinen, ist im Rahmen der vorliegenden Studie nicht erfolgt. Hier böte sich ein möglicher Ansatzpunkt für eine Folgestudie. Eng verbunden mit dem Code Luxus ist das Frauenbild, das sich in den analysierten Liedtexten abzeichnet. Frauen spielen in der Hip-Hop-Kultur im Allgemeinen und auch im hier vorliegenden Untersuchungssample eine untergeordnete Rolle. Wie bereits dargestellt, machen Künstlerinnen nur einen kleinen Anteil am Gesamtsample aus. Aber auch in den Liedtexten spielen Frauen eine marginale Rolle. Das Frauenbild in der Rap-Musik lässt Parallelen zum Konzept der hegemonialen MännlichkeitMännlichkeit bezeichnet kulturell und sozial geformte Vorstellungen davon, was als „männlich“ gilt. (Connell, 2015) erkennen (vgl. Süß, 2021). Wenn Frauen im vorliegenden Liedtextsample thematisiert werden, bleiben sie zumeist namenlos und werden – analog zu den materiellen Statussymbolen – objektiviert. Die Darstellung ist stereotyp und Frauen werden zumeist auf ihr Aussehen und ihre Sexualität reduziert. Besonders deutlich wird dies an den folgenden Liedtextstellen, in denen Frauen – hier despektierlich als „Bitch“ bezeichnet – in einem Atemzug mit Luxusgütern genannt werden:
Ah, ich trag die Pistol in der Jackentasche
Versammel‘ Bitches um die Magnum-Flasche
Mach bitte nicht auf reich mit deiner Datejust [Anmerkung: Uhrenmodell der Marke Rolex]
Mein Shirt vom Designer voller Make-Up (Brra)
Deine Bitch war einsam, sie kam vorbei
Universal ruft an, doch ich bin zu high
Frauen werden regelmäßig als willige, häufig untreue und berechnende Sexualpartnerinnen dargestellt. Im Kontext der hier zu bearbeitenden Fragestellung ist das Frauenbild v.a. im Zusammenhang mit der Selbstdarstellung der männlichen Rapper aufschlussreich. Die Darstellung der Frau als allzeit verfügbares Sexualobjekt unterstreicht die vorgebliche Promiskuität und (sexuelle) Potenz der männlichen Rapper. Dieses sexistische Frauenbild beinhaltet auch die (auch gewaltsame) „Eroberung“ der Frau oder Freundin eines konkurrierenden Rappers als Form der absoluten Demütigung des Gegners. Sie wird nur noch durch die Diffamierung der jeweiligen Mütter der konkurrierenden Rapper getoppt, wie dies in dem nachstehenden Liedtext-Zitat von Farid Bang geschieht.
Regel 7 – komm mir nicht mit Stylingtipps
Wenn an deinem Arm nicht mal ’ne Breitling ist
Und eigentlich fick‘ ich deine Bitch in einem Ford-LKW
Ich hab‘ ein‘ Stiernacken, der bis zu den Ohrläppchen geht
Ich bin Unternehmer, Schutzgeldzähler, Muskelträger, Nuttenschläger
Und das Wichtigste: Schwanz-an-deine-Mutter-Geber
Eine umfassende Betrachtung des Frauenbildes im deutschsprachigen Rap muss allerdings auch zur Kenntnis nehmen, dass die Bezeichnungen „bitch“ (engl. = Schlampe“) und das ebenfalls häufig vorkommende Wort „hoe“ (engl. = Nutte) dabei keinesfalls in allen Fällen wörtlich und negativ konnotiert zu verstehen sind. Die Begriffe stellen einen szene- und subkulturspezifischen Slang dar. Im Sinne einer Selbstermächtigung werden diese Bezeichnungen auch regelmäßig von weiblichen Künstlern selbst aufgegriffen (vgl. Süß, 2021).
Literatur
- Anderson, E. (1999). Code of the Street. Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City. Norton.
- B.Z. (2016, 02. Juni). Das sind die Blitzeinbrecher von Berlin. https://www.bz-berlin.de/polizei/das-sind-die-blitzeinbrecher-von-berlin
- Connell, R. (2015). Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten (4. Aufl.). Springer VS.
- Dollinger, B. & Rieger, J. (2023). Crime as Pop: Gangsta Rap as Popular Staging of Norm Violations. Arts 12: 21. https://doi.org/10.3390/arts12010021
- Gontek, F. (07.04.2024). 20 Jahre Sidos »Mein Block«. Sein Leben, fremde Welt. Spiegel Online. https://www.spiegel.de/kultur/musik/sido-20-jahre-mein-block-wie-der-track-den-strassenrap-in-deutschland-gepraegt-hat-a-e293cc58-0227-4057-a32c-90d3b670ebe4?sara_ref=re-xx-cp-sh
- Häussermann, H. & Kronauer, M. (2009). Räumliche Segregation und innerstädtisches Getto. In R. Castel & K. Dörre (Hrsg.), Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts (S. 113-130). Campus.
- Kubrin, C. E. (2005a). Gangstas, Thugs, and Hustlas: Identity and the Code of the Street in Rap Music. Social Problems, 52(3), 360–378. https://doi.org/10.1525/sp.2005.52.3.360
- Kubrin, C. E. (2005b). “I See Death around the Corner”: Nihilism in Rap Music. Sociological Perspectives, 48(4), 433–459. https://doi.org/10.1525/sop.2005.48.4.433
- Levitt, S. (2006, Februar). The freakonomics of crack dealing [Video]. Ted Conferences. https://www.ted.com/talks/steven_levitt_the_freakonomics_of_crack_dealing/transcript?subtitle=en
- Süß, H. (2021). Eine Szene im Wandel? Rap-Männlichkeiten zwischen Tradition und Transformation. Campus Verlag.
- The Ambition GmbH (2024). Ambition Score 2024. Düsseldorf. https://the-ambition.com/magazine/ambition-score-2024/
Fußnoten
- 1Der im Deutschrap viel verwendete Begriff Ghetto lässt klare Parallelen zum US-amerikanischen Rap erkennen, in dem Rapper von ihrer Herkunft aus den „Projects“ (gemeint sind: housing projects = Sozialbau-/ Hochhaussiedlungen) berichten. Diese Gleichsetzung der Wohnsituation ist aus einer stadtsoziologischen Perspektive nicht haltbar. Häussermann und Kronauer (2009) schreiben hierzu: „Zwar gibt es in deutschen Städten bisher keine Parallele zu den Gettos der Schwarzen, bei denen sich die Härte der Ausgrenzung aus rassistischer Diskriminierung, fehlenden sozialstaatliche Sicherungen und strikt marktförmigem Wohnungssystem ergibt, aber ähnliche Auswirkungen der sozialräumlichen Ausgrenzung sind auch in unseren Städten zu beobachten beziehungsweise zu befürchten.“ (S. 120). Die Autoren spielen hier auf den Einfluss des Wohngebietes auf Verhalten, NormenVerhaltensregeln und Erwartungen, die innerhalb einer Gesellschaft oder sozialen Gruppe als verbindlich gelten. und Lebensrisiken und -chancen an.


