Dieser Beitrag bildet den Auftakt zur inhaltlichen Auswertung des Forschungsprojekts „Rap und Polizei“. Er skizziert das Spannungsfeld zwischen Polizei und PopulärkulturKulturelle Ausdrucksform breiter Bevölkerungsschichten; oft massenmedial verbreitet und kommerziell produziert. und liefert eine theoretisch fundierte Einordnung.
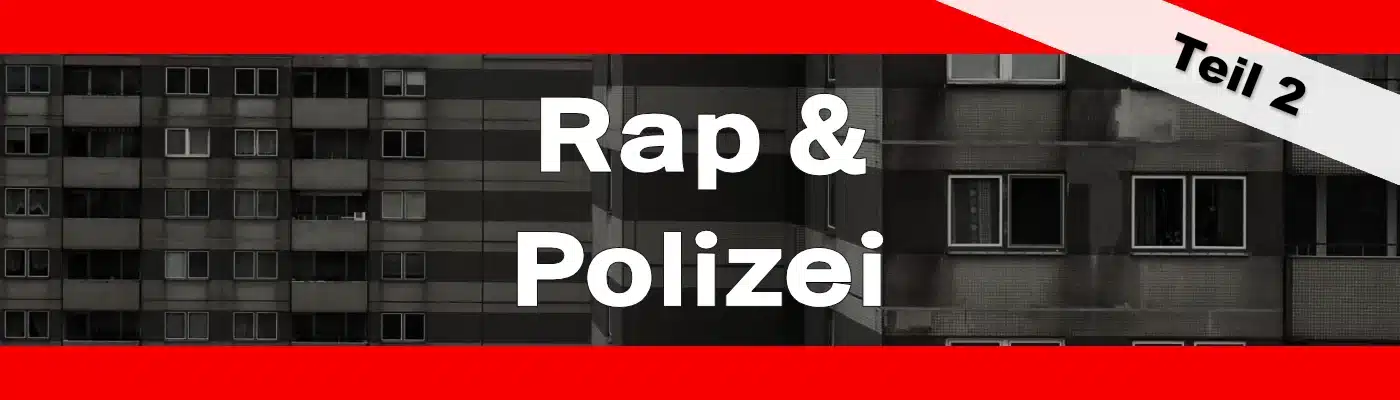
Polizeibild im gesellschaftlichen Diskurs
Vertreter der PolizeiDie Polizei ist eine staatliche Institution zur Gefahrenabwehr, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Verfolgung von Straftaten. monieren seit Jahren eine steigende Gewaltbereitschaft gegenüber Polizeibeamten. Der Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP) schrieb zuletzt in einer Pressemitteilung von einer „Zunahme von Respektlosigkeiten, Diffamierungen sowie Angriffen und Gewaltattacken auf unsere Kolleginnen und Kollegen als Repräsentantinnen und Repräsentanten unseres demokratischen Staates“ (Gewerkschaft der Polizei (GdP) – Bundesvorstand, 2022). Zahlreiche Autorinnen und Autoren haben darauf hingewiesen, dass die wissenschaftlich nicht haltbare Behauptung eines Anstiegs der Gewalt gegen Polizeibeamte (vgl. Görgen & Hunold, 2019) in ihrem Kern auf ein Gefühl von „Respektlosigkeit, Autoritätsverlust, Nichtachtung“ (Behr, 2013, S. 89) zurückzuführen ist (Gensing, 2020; Hunold, 2012; vom Hau, 2017; Weber, 2020). Der Autoritätsverlust ist dabei einerseits Folge einer Bürgerpolizei, die sich zunehmend der Zivilgesellschaft angenähert hat und hierbei gleichzeitig gegenüber einigen Bevölkerungsgruppen an Respekt eingebüßt hat (Behr, 2013). Andererseits wurde das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger durch Berichte über Korruption (Süddeutsche Zeitung, 2015), rechtsextremistische Polizeibeamte (Bundesamt für Verfassungsschutz, 2020; Parth, 2020), Racial Profiling und übermäßige Gewaltanwendung1 Exemplarisch sei hier auf das Forschungsprojekt KviAPol hingewiesen, das an der Ruhr Universität Bochum durchgeführt wurde. Die Forschenden untersuchten hier sowohl Fälle von Körperverletzungen im Amt durch PVB als auch Racial Profiling aus Opferperspektive (Abdul-Rahman et al., 2020). (Gensing, 2020) erschüttert.
Polizei in der Rap-Musik
Strukturelle Gewalt, Rassismus und PolizeigewaltPolizeigewalt beschreibt den Einsatz physischer oder psychischer Gewalt durch Polizeibeamte im Rahmen ihrer Dienstausübung. Sie kann sowohl legitim (im rechtlichen Rahmen) als auch illegitim (bei Überschreitung der Befugnisse) ausgeübt werden. sind Themen, die in der (US-amerikanischen) Rap-Musik bereits seit den 1980er Jahren verhandelt werden. Bekanntere und kontroversere Beispiele wie „Fuck the Police“ von N.W.A. (1988), „Cop Killer“ von Bodycount (1992)2Technisch handelt es sich bei „Cop Killer“ um ein Lied aus dem Genre Crossover/ Metal. Hamm und Ferrell (1994) weisen darauf hin, dass jedoch der Umstand, dass es sich bei Ice-T, dem Sänger/ Rapper der Band um einen populären US-amerikanischen Gangsta-Rapper handelt, entscheidend für die Bewertung ist. Die Autoren weisen darauf hin, dass die Bewertung eines Rap-Liedes anderen Maßstäben zu unterliegen scheint, als beispielsweise das Lied „I shot the sherrif“ in der Version des weißen Blues-Gitarristen Eric Clapton. „The social aesthetic of rap music creates a key cultural and political difference. Because rap constitutes a strident form of cultural combat and critique, it generates in response organized censorship, blacklisting, arrests, and the police-enforced cancellation of concerts.” (S. 29) oder „Sound of da Police“ von KRS One (2000) stellen dabei nur eine winzige Auswahl aus einem nur schwer überschaubaren Sujet dar. Insbesondere die wachsende Popularität des Gangsta-RapSubgenre des Hip-Hop, das Gewalt, Straßenerfahrung, Macht und Marginalisierung thematisiert. hat seit den 1990er Jahren bis heute die thematische Beschäftigung mit der Polizei zu einem allgegenwärtigen Thema in Rap-Liedtexten werden lassen. Dieses Phänomen lässt sich auch für deutschsprachige Rap-Musik beobachten (vgl. Wickert, 2018). Die Beispiele reichen dabei vom bereits 1995 erschienenen Stück „Geh zur Polizei“3Für eine ausführliche Kritik siehe (Dams, 2012) des Heidelberger Produzenten und Rappers Boulevard Bou bis zur Thematisierung der Tötung von George FloydGeorge Floyd war ein Afroamerikaner, der 2020 in Minneapolis durch Polizeigewalt starb. Sein Tod löste weltweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. durch einen US-amerikanischen Polizisten in dem Lied „I can’t breathe“ von Samy Deluxe (2020). Das hier vorliegende Forschungsprojekt sieht eine inhaltsanalytische Untersuchung der Darstellung der Polizei in deutschsprachigen Rap-Liedern vor, die zwischen 2015 und 2022 in den Charts verzeichnet waren. Nach dem theoretischen, methodologischen Verständnis der Cultural Criminology „the street scripts the screen and the screen scripts the street” (Ferrell et al., 2015, S. 151). Das Reale und das Virtuelle, das Fiktionale und das Faktuale stehen hiernach in einem immerwährenden, sich gegenseitig beeinflussenden Wechselspiel und Deutungsspirale. Respekt und AutoritätAutorität bezeichnet anerkannte, legitime Macht, die auf Zustimmung und Vertrauen basiert. werden zu kollektiven Symbolen, deren Bedeutung in Liedtexten verhandelt wird. „ACAB ist Popkultur“ (Niessen, 2017).
Cultural Criminology und der Cultural Turn
Gut fünfzig Jahre nach ihrer Entstehung in der South Bronx ist die Hip-Hop-Kultur als globale Jugendkultur fest verankert. Der Einfluss von Rap-Musik, Graffiti und Breakdance ist aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Hip-Hop-Kultur ist umfassend und zu umfangreich, um sie an dieser Stelle wiedergeben zu können. Dennoch sei auf einige Standardwerke aus dem englisch- und deutschsprachigen Raum verwiesen. Eines der ersten wissenschaftlichen Werke, das heute den Ruf eines Standardwerks zum Thema genießt, ist die musik- und kulturwissenschaftliche Arbeit „Rap Attack“, in der Toop (1992) den Ursprung der Hip-Hop-Kultur und ihren kulturellen Einfluss skizziert. Ein vergleichbares Forschungsprogramm mit einem Fokus auf Black- und Gender-Studies verfolgen die Arbeiten von Rose (1994, 2008). Für den deutschsprachigen Raum sei hier insbesondere auf die Arbeiten von Dietrich und Seeliger hingewiesen, die sich ausführlich mit deutschem Gangsta-Rap auseinandersetzen (vgl. Dietrich, 2016b; Dietrich & Seeliger, 2012; Seeliger & Dietrich, 2017). Neben den benannten Ausnahmen spielt Musik als Gegenstand soziologischer oder kriminologischer Analysen eine lediglich untergeordnete Rolle. Selbst in Standardwerken zur Mediensoziologie sucht man eine ausführlichere Beschäftigung, die über die Nennung von wenigen Schlagworten hinausgeht, oftmals vergeblich (vgl. z.B. Greer, 2010; Jewkes, 2015). Dabei hat der britische Soziologe Simon Frith auf die überragende Bedeutung von Musik für das Soziale hingewiesen. Frith (2003, S. 100 f.) schreibt:
„what people listen to is more important for their sense of themselves than what they watch or read. Patterns of music use provide a better map of social life than viewing or reading habits. Music just matters more than any other medium“ (Hervorhebung im Original).
Ein für das Ende der 2000er Jahre zu diagnostizierender Cultural Turn in den Sozialwissenschaften (vgl. Bachmann-Medick, 2006), der z.B. das Visuelle, den Raum oder aber das Auditive als zentrale Analysekategorie in den Mittelpunkt rückt, findet in der Kriminologie seinen Ausdruck in der steigenden Beschäftigung mit dem komplexen Beziehungsgeflecht aus KriminalitätKriminalität bezeichnet gesellschaftlich normierte Handlungen, die gegen das Strafgesetz verstoßen., Kriminalitätskontrolle und Kultur im Rahmen der Cultural Criminology (vgl. Ferrell et al., 2015; Ferrell & Sanders, 1995; Presdee, 2000), dem Visuellen, dem in der Visual Criminology nachgegangen wird (vgl. Hayward & Presdee, 2010) oder beispielsweise einer Sensory Criminology (vgl. McClanahan & South, 2020). Diese Arbeiten sehen sich dem interpretativen Paradigma der Soziologie verpflichtet und knüpfen an die ideologiekritische Sicht auf Medien an, wie sie in den 1960er und 1970er Jahren am Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) an der University of Birmingham entwickelt wurden. Hiernach werden jugendliche Subkulturen als subversive Kulturen einer hegemonialen Kultur verstanden, die mit einer sozialen Klasse korrespondieren und deren „latente Funktion […] in der Markierung und symbolischen Verhandlung von stammkulturellen (hegemonialen) Widersprüchen“ (Dietrich, 2016a, S. 10) besteht. Ohne eine Medienwirkungsforschung betreiben zu wollen, in der versucht würde, den unmittelbaren Einfluss der Medienrezeption auf das Verhalten der Rezipienten in statistische Kennzahlen zu gießen, liegt stattdessen der Cultural Criminology die Annahme zugrunde, dass Medienproduzenten wie auch Rezipienten als Teile des Sozialen in einem wechselseitigen Austausch- und Interpretationsprozess stehen, wobei „the street scripts the screen and the screen scripts the street“ (Hayward & Young, 2004).
Zur Entwicklung einer auditiven Kriminologie
In dem Kontext eines Cultural Turn ist auch die kulturwissenschaftliche, devianzsoziologische und kriminologische Beschäftigung mit Klang und Musik einzuordnen, die als „auditive criminology“ (Hayward, 2012), „auditive KriminologieKriminologie ist die interdisziplinäre Wissenschaft über Ursachen, Erscheinungsformen und gesellschaftliche Reaktionen auf normabweichendes Verhalten. Sie untersucht insbesondere Prozesse sozialer Kontrolle, rechtliche Rahmenbedingungen sowie individuelle und strukturelle Einflussfaktoren.“ (Wickert, 2017a, 2017b) oder „Musicriminology“ (Lee, 2021) bezeichnet werden kann. Während eine auditive Kriminologie nicht alleine auf Musik beschränkt ist und z.B. Töne, Lärm und Krach als soziale Phänomene begreift und ihre Verwendung im Kontext von Kriminalität und Kriminalitätskontrolle (z.B. Folter, Einsatz von Schallkanonen, hochfrequente Töne zur Vertreibung von Jugendlichen aus dem öffentlichen Raum usw.) betrachtet, ließe sich „Musicriminology“ begreifen als “the study of lyrics, and subcultural style as texts of resistance, marginalisation, redemption, criminalisation, or soundtracks of deviancy” (Lee, 2021, S. 3). Nach Lee (ebd.) eröffnet diese Analyse den Blick auf “markers of class, gender, sexuality, ethnicity, race and socio-economic conditions – as well as symbolic collective meaning.” Wenngleich teilweise älter als der von Lee geprägte Begriff der „Musicriminology“ oder das Label „auditive Kriminologie“ lassen sich eine Reihe von Arbeiten finden, die unter die o.g. Definitionen fallen und die eine theoretische Rahmung der anzufertigen Arbeit bilden. Johnson und Cloonan (2008), Capers (2009), Hirsch (2012), Deflem (2013), Wickert (2017b), Peters (2019) sowie zuletzt Siegel und Bovenkerk (2021) legen Übersichtsarbeiten vor, die das Programm einer auditiven Kriminologie umreißen. Spezifischer auf die Analyse von Liedtexten stellen die Arbeiten von Kubrin (2005a, 2005b), Henderson und Steinmetz (2016) sowie Steinmetz und Henderson (2012) ab. Die vier letztgenannten Arbeiten beschäftigen sich mit der Analyse US-amerikanischen Rap-Liedern. Die Arbeiten von Fatsis (2019) und Ilan (2020) beschäftigen sich hingegen mit Gewaltdarstellungen in Liedtexten und vor allem der KriminalisierungDer Prozess, durch den bestimmte Handlungen oder Verhaltensweisen durch gesetzliche Bestimmungen als kriminell definiert und strafrechtlich verfolgt werden. von Künstlern im Kontext von Grime- bzw. Drill-Music – einem Subgenre des Rap, das sich insbesondere in Großbritannien einer großen Beliebtheit erfreut. Die rechtssoziologische Arbeit von Nielson und Dennis (2019) befasst sich mit dem alarmierenden Trend, dass in den USA Staatsanwälte Liedtexte als belastende Beweismittel in Gerichtsprozessen anführen und somit die Grenze zwischen gesetzlich verankerter Kunstfreiheit auf der einen und dem Anspruch der Rapper auf „Realness“ auf der anderen Seite verwischt. Schließlich ist noch die Arbeit von Dams (2012) hervorzuheben, die sich mit der Darstellung der Polizei in der deutschsprachigen Populärmusik beschäftigt.
Eine Wiedergabe des Forschungsstandes zum Thema Hip-Hop-Kultur und Raum wäre eine Forschungsarbeit für sich und lässt sich im Rahmen dieses Forschungsberichtes nicht bewerkstelligen. Es sei daher nur exemplarisch auf einige wenige Arbeiten hingewiesen: Mit Blick auf US-amerikanischen Hip Hop legt Forman (2004) einen umfassenden Übersichtsbeitrag vor. Klein und Friedrich (2011) analysieren Hip-Hop als Phänomen der Glokalisation; vergleichbar konstatiert Ilan (2015), das „facets of street culture […] can be observed to exist globally and others which are particular local variants“ (S. 12). Janitzki (2012) zeigt exemplarisch am Beispiel einiger aus Berlin stammender Rapper, das Potential einer Liedtextanalyse für stadtsoziologische Forschung auf. Schließlich sei an dieser Stelle noch auf die viel rezitierte ethnographische, stadtsoziologische Forschungsarbeit von Anderson (1999) verwiesen. Der hier beschriebene „Code of the Street“, verstanden als von der Mehrheitsgesellschaft abweichendes normatives Set an Regeln und Überzeugungen, das gewalttätiges Handeln legitimiert und staatliche Autoritäten delegitimiert, dient wiederum Kubrin (2005a) als theoretische Fundierung ihrer Analyse von Rap-Liedtexten – auch vor dem Hintergrund kriminalitätsbelasteter, sozial benachteiligter „inner-city communities“.
Zahlreiche Arbeiten beschäftigen sich – v.a. aus Perspektive der Psychologie und Medizin – mit dem Zusammenhang von Musikhörgewohnheiten und Konsumpräferenzen der Hörerschaft in Hinblick auf unterschiedliche legale und illegalisierte Substanzen (vgl. z.B. Christenson et al., 2012; Primack et al., 2008; Vuolo et al., 2014). Im Gegensatz hierzu vertreten die Arbeiten von Bogazianos (2012), Spunt (2014) und Kemper (2001) eine explizit kriminologische Perspektive. Insbesondere die erstgenannte Arbeit erscheint relevant mit ihrem Fokus „on the degree to which crack cocaine emerged as a primary symbolic referent through the development of an important reflexive lyrical stance that many rap artists in the 1990s took toward their own commercialization” (S. 2).
Forschungsstand zur Polizeidarstellung in Raptexten
Schlussendlich lassen sich einige wenige Arbeiten anführen, die sich – wie die hier vorliegende Forschungsarbeit – direkt oder zumindest mittelbar mit der Darstellung der Polizei in Rap-Liedtexten befassen. Hierbei beschränkt sich die folgende Darstellung auf Arbeiten die einen umfangreicheren Liedtext-Korpus untersucht haben und über Analysen einzelner Liedtexte oder Künstler hinausgehen. Kubrin (2005a) untersucht 403 englischsprachige Rap-Liedtexte, die zwischen 1992 und 2000 erschienen sind. Im Fokus ihrer Arbeit steht das Thema GewaltGewalt bezeichnet die absichtliche Anwendung körperlicher oder psychischer Kraft zur Schädigung von Personen oder Dingen. und die Frage „how rappers’ lyrics actively construct violent identities for themselves and for others (S. 361). In enger Anlehnung an Andersons Arbeit zum „Code of the street“ (1999) orientiert sich die Forscherin auf die Themen/ Codes „(1) respect, (2) willingness to fight or use violence, (3) material wealth, (4) violent retaliation, (5) objectification of women, and (6) nihilism“ (S. 367). Insbesondere die Codes Respekt und die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden weisen eine große Schnittmenge zum Thema Polizei auf. Dies betrifft zum einen die Gewaltanwendung von Bewohnern innerstädtischer, benachteiligter Communities an sich, aber auch die (ungerechtfertigte) Gewaltanwendung der Polizei gegen die Bewohner und eine hieraus abgeleitete Ablehnung der Polizei per se:
„Residents of disadvantaged black communities, arguably those most in need of police protection, tend to be wary of the police, in part because of concerns about racial profiling and the possibility of being wrongfully accused. These practices cause residents who might otherwise assist the police to avoid them, to not cooperate with investigations, to assume dishonesty on the part of officers, and to teach others that such reactions are prudent lessons of survival on the streets (Anderson 1990; Kennedy 1997:153; Kubrin and Weitzer 2003).“ (Kubrin, 2005a, S. 362).
Der US-amerikanische Jurist Paul Butler legt 2005 eine “Hip Hop Theory of Justice and Punishment” vor. Die Arbeit beruht zwar nicht auf einer systematischen inhaltsanalytischen Untersuchung von Liedtexten, jedoch wird die Argumentation durch zahlreiche zitierte Liedtextpassagen untermauert. Ausgangspunkt der Argumentation sind die hohen Inhaftierungsraten in den USA insbesondere für schwarze, junge Männer. Das US-amerikanische Rechtssystem würde, so Butler, People of Colour benachteiligen und dagegen Unternehmen, Angehörige der Oberschicht bevorzugt behandeln. In der Hip-Hop-Kultur spielten Vergeltung und Respekt eine entscheidende Rolle. Diese schließe sehr wohl auch die gerechte Bestrafung von Tätern ein. Jedoch müsse hierbei auch der negative Effekt einer Strafe auf die GemeinschaftEine Gemeinschaft ist eine Form des sozialen Zusammenlebens, die sich durch enge persönliche Bindungen, emotionale Nähe und ein starkes Wir-Gefühl auszeichnet. Der Begriff wurde maßgeblich durch Ferdinand Tönnies geprägt, der ihn als Gegensatz zur Gesellschaft verstand. berücksichtigt werden.
„Three core principles inform hip-hop’s own ideas about punishment. First, people who harm others should be harmed in return. Second, criminals are human beings who deserve respect and love. Third, communities can be destroyed by both crime and punishment.“ (S. 133)
Steinmetz und Henderson (2012) untersuchen eine Zufallsstichprobe von 200 englischsprachigen Rap-Liedtexten, die zwischen 2000 und 2010 erschienen sind und den Platinstatus in den US-amerikanischen Charts erreicht haben. Hierbei liegt ihr Fokus auf der Darstellung der Polizei, des Gefängnisses und der Gerichte. In Hinblick auf die Darstellung der Polizei machen die Forschenden drei Themen/ Codes ausfindig: „law enforcement as hunters, law enforcement as oppressors, and law enforcement as illegitimate“ (S. 163). Bei dem erstgenannten Code wird die Polizei als Verfolger und ÜberwachungÜberwachung beschreibt die systematische Sammlung, Beobachtung und Analyse von Informationen über Personen, Gruppen oder Institutionen, meist durch staatliche oder private Akteure. dargestellt, die Menschen in ihrer (illegalen) Lebensführung einschränken. Unter „Law enforcement as oppressors“ fassen die Autoren Liedtextstellen, in denen die Polizei als Gefahr und zugleich Quelle der Gewalt angesehen wird, die eine soziale vertikale Mobilität verhindert. Unter dem Code „Law enforcement as illegitimate“ werden schließlich Liedtextstellen gefasst, in denen die Polizei als Lügner, korrupt, brutal, diskriminierend etc. dargestellt wird. Die Autoren machen Unfairness und (fehlenden) Respekt als maßgebliche Themen der von ihnen untersuchten Liedtextstellen aus:
„After examining the hip-hop portrayals of criminal justice in this research, two overarching themes emerged. The first theme is unfairness. In examining the various themes from law enforcement (as predatory, as oppressors, and as illegitimate) and corrections (separates social ties, conditions and effects, oppressive, punishment as appropriate, and nondescript negative) in addition to the findings for the judicial branch of the criminal justice system, many of the discussions portray the operations and actions of the system as patently unfair, which has ramifications from a procedural justice perspective (Tyler, 2006). […] Along with the descriptions of unfairness is also an obvious lack of respect for the criminal justice system within these lyrics primarily as result of being the victim of unjust treatment. (S. 171 f.).
Hieraus leiten die beiden Wissenschaftler eine Forderung nach einer besseren Verfahrensgerechtigkeit (procedural justice) ab.
Fazit zum Forschungsstand
Zum Abschluss dieses Forschungsüberblicks sei schließlich noch auf die theoretische Arbeit von Dollinger und Rieger (2023) verwiesen, die das Konzept „Crime as Pop“ am Beispiel des Gangsta-Rap illustrieren. Hierzu erarbeiten sie die idealtypische Erzählung im Gangsta-Rap. Ausgangspunkt sei hier der Wunsch nach sozialem Aufstieg (from rags to riches), der in vielen Gangsta-Rap-Liedern präsent ist. Der Rapper stelle einen Anti-Helden dar. Sein sozialer Aufstieg rechtfertige kriminelles Verhalten. Hierbei müsse der Rapper sich und seinem Umfeld authentisch bleiben. D.h., der soziale Aufstieg soll ohne eine soziale Transformation erfolgen. Herkömmliche Mittel der Zielerreichung (z.B. formale Bildungsabschlüsse, Erwerbsarbeit) würden abgelehnt. Zur Zielerreichung und unter Bewahrung der Authentizität müssen Widerstände überwunden werden (Polizei, GesellschaftEine Gesellschaft ist ein strukturiertes Gefüge von Menschen, die innerhalb eines geografischen Raumes unter gemeinsamen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen leben und durch institutionalisierte soziale Beziehungen miteinander verbunden sind., andere Rapper etc.). Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die hier vorgestellten Arbeiten bei unterschiedlicher Akzentuierung doch große inhaltliche Parallelen aufweisen. In allen Forschungsarbeiten wird soziale Ungleichheit als Motivator für individuelles Handeln herausgestellt. Der Wunsch nach einem sozialen und v.a. wirtschaftlichen Aufstieg ist eng verbunden mit Respekt.
Literatur
- Abdul-Rahman, L.; Espín Grau, H.; Singelnstein, T. (2020). Polizeiliche Gewaltanwendungen aus Sicht der Betroffenen. Zwischenbericht zum Forschungsprojekt „Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamt*innen“ (KviAPol). 2. Auflage. Ruhr-Universität Bochum, 26.10.2020, https://kviapol.rub.de.
- Anderson, E. (1999). Code of the Street. Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City. Norton.
- Bachmann-Medick, D. (2006). Cultural Turns: Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Behr, R. (2013). Polizei. Kultur. Gewalt. Die Bedeutung von Organisationskultur für den Gewaltdiskurs und die Menschenrechtsfrage in der Polizei. SIAK-Journal − Zeitschrift Für Polizeiwissenschaft Und Polizeiliche Praxis, 1, 81–93. https://doi.org/10.7396/2013_1_H
- Bogazianos, D. A. (2012). 5 grams: crack cocaine, rap music, and the War on Drugs. New York University Press.
- Bundesamt für Verfassungsschutz. (2020). Lagebericht: Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden. Köln.
- Butler, P. (2004). Much Respect: Towards a Hip-Hop Theory of Punishment. Stanford Law Review, 56, S. 983-1016.
- Capers, I. B. (2009). Legal Studies Research Paper Series Crime Music. Ohio State Journal of Criminal Law, 7(1).
- Christenson, P., Roberts, D. F., & Bjork, N. (2012). Booze, Drugs, and Pop Music: Trends in Substance Portrayals in the Billboard Top 100-1968-2008. Substance Use & Misuse, 47, 121–129. https://doi.org/10.3109/10826084.2012.637433
- Dams, C. (2012). Polizei, Protest und Pop. Staatliche Ordnungsmacht und gesellschaftliches Aufbegehren in der Popularmusik seit 1970. In S. Mecking & Y. Wasserloos (Hrsg.), Musik – Macht – Staat. Kulturelle, soziale und politische Wandlungsprozesse in der Moderne (S. 303–318). V&R unipress.
- Deflem, M. (Hrsg.). (2013). Music and Law. Emerald.
- Dietrich, M. (2016a). Rap im 21. Jahrhundert: Bestandsaufnahme und Entwicklungslinien – eine Einleitung. In M. Dietrich (Hrsg.), Rap im 21. Jahrhundert. Eine (Sub-)Kultur im Wandel (S. 7–26). transcript.
- Dietrich, M. (Hrsg.). (2016b). Rap im 21. Jahrhundert: eine (Sub-)Kultur im Wandel. transcript.
- Dietrich, M., & Seeliger, M. (Hrsg.). (2012). Deutscher Gangsta-Rap: sozial- und kulturwissenschaftliche Beiträge zu einem Pop-Phänomen. transcript.
- Dollinger, B. & Rieger, J. (2023). Crime as Pop: Gangsta Rap as Popular Staging of Norm Violations. Arts 12: 21. https://doi.org/10.3390/arts12010021
- Fatsis, L. (2019). Grime: Criminal subculture or public counterculture? A critical investigation into the criminalization of Black musical subcultures in the UK. Crime, Media, Culture, 15(3), 447–461. https://doi.org/10.1177/1741659018784111
- Ferrell, J., Hayward, K., & Young, J. (2015). Cultural Criminology: An Invitation (2. Aufl.). Sage.
- Ferrell, J., & Sanders, C. (Hrsg.). (1995). Cultural Criminology. Northeastern University Press.
- Forman, M. (2004). “Represent”: Race, Space, and Place in Rap Music. In M. Forman & M. A. Neal (Hrsg.), That’s the Joint! The Hip-Hop Studies Reader (S. 201–222). Routledge.
- Frith, S. (2003). Music and Everyday Life. In M. Clayton, T. Herbert, & R. Middleton (Hrsg.), The Cultural Study of Music (S. 92–112). Routledge.
- Gensing, P. (2020, August 19). Debatte über Gewalt: Was darf die Polizei? Tagesschau.de. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/polizeigewalt-125.html
- Gewerkschaft der Polizei (GdP) – Bundesvorstand. (2022, 8. Februar). Resolution: Gewalt gegen Polizeibeschäftigte darf nicht als Berufsrisiko kleingeredet werden – Gewerkschaft der Polizei. https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/DE_Resolution-Gewalt-gegen-Polizeibeschaeftigte-darf-nicht-als-Berufsrisiko-kleingeredet-werden?open&ccm=000
- Görgen, T., & Hunold, D. (2019). Gewalt durch und gegen Polizistinnen und Polizisten . In D. Kugelmann (Hrsg.), Polizei und Menschenrechte (S. 121–135). Bundeszentrale für politische Bildung.
- Greer, C. (Hrsg.). (2010). Crime and media: a reader. Routledge.
- Hamm, M. S., & Ferrell, J. (1994). Rap, Cops, and Crime: Clarifying the “Cop Killer” Controversy. ACJS Today, 13(1).
- Hayward, K. J. (2012). Five Spaces of Cultural Criminology. British Journal of Criminology, 52(3), 441–462. https://doi.org/10.1093/bjc/azs008
- Hayward, K. J., & Presdee, M. (Hrsg.). (2010). Framing crime: cultural criminology and the image. Routledge.
- Hayward, K. J., & Young, J. (2004). Cultural Criminology: Some Notes on the Script. Theoretical Criminology, 8(3), 259–273. https://doi.org/10.1177/1362480604044608
- Henderson, H., & Steinmetz, K. (2016). Hip-Hop’s Criminological Thought: A Content Analysis. Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 18(1), 114–131.
- Hirsch, L. E. (2012). Music in American crime prevention and punishment. The University of Michigan Press.
- Hunold, D. (2012). Polizeiliche Zwangsanwendungen gegenüber Jugendlichen. Innen- und Außenperspektiven. In T. Ohlemacher & J.-T. Werner (Hrsg.), Empirische Polizeiforschung XIV: Polizei und Gewalt (S. 107–128). Verlag für Polizeiwissenschaften.
- Ilan, J. (2020). Digital Street Culture Decoded: Why criminalizing drill music is Street Illiterate and Counterproductive. British Journal of Criminology, 60(4), 994–1013. https://doi.org/10.1093/bjc/azz086
- Ilan, J. (2015). Understanding Street Culture. Poverty, Crime, Youth and Cool. Palgrave.
- Janitzki, L. (2012). Sozialraumkonzeptionen im Berliner Gangsta-Rap. Eine stadtsoziologische Perspektive. In M. Dietrich & M. Seeliger (Hrsg.), Deutscher Gangsta-Rap. Sozial- und kulturwissenschaftliche Beiträge zu einem Pop-Phänomen (S. 285–308). transcript.
- Jewkes, Y. (2015). Media & Crime (3. Aufl.). SAGE.
- Johnson, B., & Cloonan, M. (2008). Dark side of the tune: popular music and violence. Ashgate.
- Kemper, W.-R. (2001). Kokain in der Musik: Bestandsaufnahme und Analyse aus kriminologischer Sicht. Lit.
- Klein, G., & Friedrich, M. (2011). Is this real? die Kultur des HipHop (Orig.-Ausg., 4. Aufl., Issue 2315). Suhrkamp.
- Kubrin, C. E. (2005a). Gangstas, Thugs, and Hustlas: Identity and the Code of the Street in Rap Music. Social Problems, 52(3), 360–378. https://doi.org/10.1525/sp.2005.52.3.360
- Kubrin, C. E. (2005b). “I See Death around the Corner”: Nihilism in Rap Music. Sociological Perspectives, 48(4), 433–459. https://doi.org/10.1525/sop.2005.48.4.433
- Lee, M. (2021). This Is Not a Drill: Towards a Sonic and Sensorial Musicriminology. Crime, Media, Culture, 18(3). https://doi.org/10.1177/17416590211030679
- McClanahan, B., & South, N. (2020). ‘All Knowledge Begins with the Senses’1: Towards a Sensory Criminology. The British Journal of Criminology, 60(1), 3–23. https://doi.org/10.1093/bjc/azz052
- Nielson, E., & Dennis, A. L. (2019). Rap on Trial. Race, Lyrics, and Guilt in America. The New Press.
- Niessen, B. (2017, August 22). “Niemand will Bulle sein” – Ist der Polizeiberuf zu unattraktiv? VICE. https://www.vice.com/de/article/nee3yx/niemand-will-bulle-sein-ist-der-polizeiberuf-zu-unattraktiv
- Parth, C. (2020, September 16). Rechtsextreme Chatgruppen: Nur ein weiterer Stich in eine Blase. Zeit Online. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-09/rechtsextreme-chatgruppen-polizei-rassismus-problem-nrw
- Peters, E. (2019). The use and abuse of music: criminal records. Emerald Publishing.
- Presdee, M. (2000). Cultural Criminology and the Carnival of Crime. Routledge.
- Primack, B. A., Dalton, M. A., Carroll, M. v, Agarwal, A. A., & Fine, M. J. (2008). Content Analysis of Tobacco, Alcohol, and Other Drugs in Popular Music. Arch Pediatr Adolesc Med, 162(2), 169–175.
- Rose, T. (1994). Black noise: rap music and black culture in contemporary America. University Press of New England.
- Rose, T. (2008). The hip hop wars: what we talk about when we talk about hip hop–and why it matters. BasicCivitas.
- Seeliger, M., & Dietrich, M. (Hrsg.). (2017). Deutscher Gangsta-Rap II. Popkultur als Kampf um Anerkennung und Integration (Issue Band 50). Transcript.
- Siegel, D., & Bovenkerk, F. (Hrsg.). (2021). Crime and music. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49878-8
- Spunt, B. (2014). Heroin and Music in New York City. Palgrave Macmillan.
- Steinmetz, K. F., & Henderson, H. (2012). Hip-Hop and Procedural Justice: Hip-Hop Artists’ Perceptions of Criminal Justice. Race and Justice, 2(3), 155–178. https://doi.org/10.1177/2153368712443969
- Süddeutsche Zeitung. (2015, 9. Februar). Kempten: Sechseinhalb Jahre Haft für Ex-Drogenfahnder. Süddeutsche Zeitung. https://www.sueddeutsche.de/bayern/prozess-im-allgaeu-sechseinhalb-jahre-haft-fuer-ex-drogenfahnder-1.2342833
- Toop, D. 1949-. (1992). Rap-Attack African Jive bis Global HipHop. Hannibal Verlag.
- vom Hau, S. (2017). Autorität reloaded. Eine Neukonzeption gegen Gewalteskalationen im Polizeidienst. Springer VS.
- Vuolo, M., Uggen, C., & Lageson, S. (2014). Taste clusters of music and drugs: evidence from three analytic levels. The British Journal of Sociology, 65(3), 529-554. https://doi.org/10.1111/1468-4446.12045
- Weber, M. (2020). Relevanz von Autorität und Respekt für polizeiliches Handeln. Wie entstehen polizeiliche Autorität und Respekt und wie können sie in polizeiliches Handeln integriert werden? SIAK-Journal – Zeitschrift Für Polizeiwissenschaft Und Polizeiliche Praxis, 4, 13–22. https://doi.org/10.7396/2020_4_B
- Wickert, C. (2018). “Ich hab’’ Polizei“ – Die Darstellung der Polizei in deutschsprachigen Rapliedern.” In A. Mensching & A. Jacobsen (Hrsg.), Empirische Polizeiforschung XXI: Polizei im Spannungsfeld von Autorität, Legitimität und Kompetenz (S. 163–183). Verlag für Polizeiwissenschaft.
- Wickert, C. (2017a). Auditive Kriminologie. Verbrechensdarstellung in Liedtexten aus der angloamerikanischen Musiktradition. Juridikum, 1/2017, 90–99.
- Wickert, C. (2017b). Kriminologie und Musik: Haft und Gefängnis in der englischsprachigen Populärmusik (1954-2013). Beltz Juventa.
Fußnoten
- 1Exemplarisch sei hier auf das Forschungsprojekt KviAPol hingewiesen, das an der Ruhr Universität Bochum durchgeführt wurde. Die Forschenden untersuchten hier sowohl Fälle von Körperverletzungen im Amt durch PVB als auch Racial Profiling aus Opferperspektive (Abdul-Rahman et al., 2020).
- 2Technisch handelt es sich bei „Cop Killer“ um ein Lied aus dem Genre Crossover/ Metal. Hamm und Ferrell (1994) weisen darauf hin, dass jedoch der Umstand, dass es sich bei Ice-T, dem Sänger/ Rapper der Band um einen populären US-amerikanischen Gangsta-Rapper handelt, entscheidend für die Bewertung ist. Die Autoren weisen darauf hin, dass die Bewertung eines Rap-Liedes anderen Maßstäben zu unterliegen scheint, als beispielsweise das Lied „I shot the sherrif“ in der Version des weißen Blues-Gitarristen Eric Clapton. „The social aesthetic of rap music creates a key cultural and political difference. Because rap constitutes a strident form of cultural combat and critique, it generates in response organized censorship, blacklisting, arrests, and the police-enforced cancellation of concerts.” (S. 29)
- 3Für eine ausführliche Kritik siehe (Dams, 2012)


