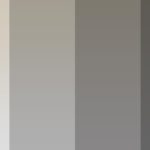Einleitung
Bevor ich erläutere, was Racial oder Ethnic Profiling ist, würde ich Sie, lieber Leser, bitten, einmal folgende Sätze zu lesen:
Alles klar? Konnten Sie die Sätze lesen? Vermutlich war es ein Leichtes für Sie zu erkennen, dass ich schlicht die Vokale gestrichen habe aus den Sätzen „Menschen sind sehr gut darin, Muster zu erkennen. Es hilft Ihnen im Alltag zurecht zu kommen, indem sie Situationen schnell einschätzen können“. Sofern wir keine Leseanfänger sind, ergänzt unser Gehirn die fehlenden Buchstaben, da es aufgrund unserer Erfahrung erkennt, dass Mnschn für Menschen und Mstr für Muster stehen muss usf. Dieser Mechanismus ist aber natürlich nicht alleine auf Sprache beschränkt, sondern funktioniert auch bei der Beurteilung von Situationen. Auch hier können wir dies an einem einfachen Beispiel festmachen. Denken Sie doch bitte einmal an einen Kiffer! Wie, glauben Sie, sieht der typische Cannabiskonsument aus? Ich bin mir sicher, dass Sie jetzt, ob Sie wollen oder nicht, ein Bild vor Ihrem geistigen Auge haben. Vielleicht denken Sie gerade an Moritz Bleibtreu in seiner Rolle in Lammbock oder an den US-amerikanischen Rapper Snoop Dogg oder einen Menschen aus Ihrem Bekanntenkreis oder, oder, oder.
Der Mechanismus, der den vorgenannten Beispielen zugrunde liegt, lässt sich soziologisch als eine Reduktion der Komplexität der Umwelt beschreiben. Unser Gehirn kategorisiert und typisiert unsere Wahrnehmungen aufgrund unseren bisherigen Erfahrungen. Im Laufe unseres Lebens erfahren und erlernen wir z.B. soziale Rollen mitsamt ihren verbundenen Anforderungen und Erwartungen. Durch dieses Erfahrungswissen wird der Möglichkeitsspielraum unserer Handlungen (in der Soziologie spricht man hier auch von der Kontingenz) beschränkt. Aus einem theoretisch unerschöpflich großen Handlungsspielraum, können wir durch die im Bruchteil einer Sekunde stattfindenden Einordnung durch unser Gehirn die meisten Handlungsoptionen ausschließen. Hebt der Studierende während des Unterrichts die Hand, wird er vermutlich weder einen Ball fangen noch seinem Sitznachbarn eine Ohrfeige verpassen wollen. Der Dozent wird aufgrund seines Erfahrungswissens die Situation einschätzen und ein Handzeichen erkennen, das signalisiert, dass der Studierende einen Wortbeitrag leisten möchte.
Mit dieser längeren Einleitung in das Thema Racial/ Ethnic Profiling wollte ich verdeutlichen, dass
- jeder von uns mit Erwartungshaltungen, Schablonen, Vorurteilen, Erfahrungen ausgestattet ist, von denen wir uns nicht freimachen können und
- diese Erwartungshaltungen, Schablonen, Vorurteilen, Erfahrungen uns überhaupt erst in sozialen Situationen handlungsfähig machen, da wir ansonsten durch die Komplexität der Umwelt und den unendlichen theoretischen Handlungsspielraum überfordert wären.
Mit dieser soziologischen Einordnung möchte ich aber keinesfalls zum Ausdruck bringen, Racial/ Ethnic Profiling wäre unumgänglich und alternativlos oder sonst in irgendeiner Form entschuldbar.
Was ist Racial/ Ethnic Profiling?
Es existiert keine einheitliche Definition von Racial oder Ethnic Profiling (siehe ausführlich in: Bender, 2019). Unterschiedliche Institutionen und Personen nutzen verschiedene Definitionen, die im Kern jedoch alle einen vergleichbaren Sinngehalt haben. Nachfolgend sind exemplarisch zwei Definitionen abgebildet.
Definition 1
Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) definiert Racial Profiling als eine „ohne objektive und vernünftige Begründung erfolgende polizeiliche Berücksichtigung von Merkmalen wie Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationale oder ethnische Herkunft im Rahmen von Kontrollen, Überwachungen oder Ermittlungen“ (ECRI, 2007, S. 4).
Definition 2
„[…] actions initiated by agents/ officials of the State […] that treat people differently solely on the basis of their real or assumed ‚race‘, ethnicity, religion or national origin, rather than responding to the behavior of an individual, a suspect description or other intelligence.“
(European Union Agency for Fundamental Rights, 2007: 2)
Die Begriffe Racial Profiling und Ethnic Profiling werden synonym genutzt. Vor allem im englischsprachigen Raum wird der Begriff Racial Profiling öfter verwendet. Ich plädiere hingegen für die Verwendung von Ethnic Profiling, da der Begriff des Racial Profiling suggeriert, es gäbe unterschiedliche menschliche Rassen, die z.B. an ihrer Hautfarbe festzumachen wären. Die Annahme von ,Rasse‘ als biologische Kategorisierung von Artunterschieden ist jedoch unzutreffend. Die einzige menschliche Rasse ist homo sapiens, wobei unterschiedliche Hautfarben auf eine phänotypische Ausprägung eines Genotyps zurückzuführen sind (siehe hierzu ausführlich: Cremer, 2010).
Ursprung von Profiling in der Kriminologie
Die Verwendung von Profilen als Grundlage einer datengetriebenen Wissenschaft hängt in der Kriminologie mit der sog. Actuarial Justice zusammen. Hinter diesem Begriff stehen verschiedene „techniques that use statistics to represent the distribution of variables in a population’ and consists in ‘circuits of testing and questioning, comparing and ranking“ (Simon, 1988: 771). Unter Actuarial Justice fallen kriminalpolitische und strafjustizielle Ansätze, denen gemein ist, dass eine zukunftsgerichtete Risikoeinschätzung auf Grundlage statistischer Zusammenhänge vorgenommen wird. Spätestens seit den 19080er Jahren haben solche Ansätze, wie z.B. der Routine Activity Approach an Bedeutung gewonnen, bei denen die Minimierung von Risiken im Mittelpunkt stehen. Die Individualität von Täter und Opfer spielen hier keine Rolle. Entscheidend ist, den Zugang des Täters zum Tatobjekt zu erschweren. Die Rehabilitation von Tätern steht hinter einer prognostischen Betrachtung von Risiken zurück. Dieser Idee folgend, lässt sich eine Risikominimierung erreichen, indem nicht länger eine – in manchen Fällen vergebliche – Resozialisierung angestrebt wird, sondern potentielle (Wiederholungs-)Täter zu langjährigen Haftstrafen verurteilt werden.
Vom Criminal Profiling zum Racial/ Ethnic Profiling
Die zuvor benannte Logik der Risikominimierung fand und findet in polizeilichen Ermittlungsansätzen Anwendung. Da hier zumeist die Ethnie der (potentiellen) TäterInnen keine Rolle spielt, muss hier von einem Criminal Profiling gesprochen werden. Beispiele für ein Criminal Profiling finden sich bei dem Profiling von Flugzeugpassagieren zwecks Prävention von Flugzeugentführungen oder das (den meisten vermutlich aus Hollywood-Spielfilmen bekannte) Profiling von Serienmördern oder die Entwicklung von Profilen „typischer“ Drogenkuriere usw. Entsprechend ließe sich Criminal Profiling folgendermaßen definieren:
Ein Profiling beruht zunächst auf der Beobachtung und Sammlung möglichst vieler Daten. Anschließend wird der Datenpool auf Beziehungen der Variablen untereinander untersucht. Bei diesem „Data Mining“ wird geschaut, mit welchen Merkmalen Variable X in einen statistisch messbaren Zusammenhang zu bringen ist. In der Statistik spricht man auch von einer Korrelation. Eine Korrelation kann allerdings auch zufällig entstehen und gibt keinen Aufschluss über die Kausalität.
„Immer wenn ich meinen lila Pullover trage, fängt es nachmittags an zu regnen.“In diesem Beispiel korrelieren das Tragen eines lila Pullovers mit dem Einsetzen von Regen am Nachmittag. Dieser statistische Zusammenhang lässt sich berechnen und wird sich möglicherweise auch als hoch signifikant erweisen. Dennoch ist hier offensichtlich, dass das Tragen des Pullovers nicht kausal – d.h., ursächlich – für den einsetzenden Regen sein wird.
Ein auf diese Art ermittelter Zusammenhang zwischen verschiedenen Variablen kann jetzt in einem letzten Schritt dazu genutzt werden, zurückliegende Ereignisse zu beschreiben. In diesem Fall spricht man von ex-post profiling (z.B. viele Serienmörder sind bereits im Jugendalter als Tierquäler und Brandstifter auffällig geworden). Noch aussagekräftiger ist jedoch ein ex-ante profiling, bei dem die Korrelation von Merkmalen genutzt wird, um auf zukünftige Entwicklungen zu schließen (sog. predictive profiling) (z.B. auf der Suche nach einem der Polizei noch unbekannten Serienmörder werden systematisch die Alibis von Menschen überprüft, die in Ihrer Jugend als Tierquäler und Brandstifter in Erscheinung getreten sind).
Von Racial oder Ethnic Profiling spricht man, wenn Merkmalen wie Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationale oder ethnische Herkunft Entscheidungsgrundlage für die Durchführung polizeilicher Maßnahmen sind. Ihnen liegt dann zumeist eine (mutmaßliche) Korrelation zwischen den benannten Eigenschaften und kriminalitätsauffälligem Verhalten zu Grunde.
Die Wirksamkeit von Racial Profiling
Nehmen wir einmal an, dass die Polizei in der Vergangenheit wiederholt illegale Drogen bei Personen mit der Nationalität X gefunden hat. Es besteht der Verdacht, dass der Drogenhandel in der Stadt Y maßgeblich durch Menschen mit der Nationalität X organisiert und durchgeführt wird. Seitens der Polizeiführung entscheidet man sich jetzt, die Ermittlungsaktivitäten auf den Kreis potentieller Dealer der Herkunft X zu fokussieren. Zu diesem Zweck finden vermehrt Personen- und Fahrzeugkontrollen statt. Die Strategie scheint für die Polizei aufzugehen: Regelmäßig finden die kontrollierenden Polizisten bei Personen, die sie dem äußeren Anschein nach der Nationalität X zuordnen können, Drogen. Die Erfolge bestärken die Polizei, die Strategie beizubehalten und die Kontrollen weiter zu intensivieren.
Das kleine Beispiel illustriert, dass Racial Profiling aus Perspektive der Strafverfolgung kurzfristig erfolgreich sein kann. Durch die verdachtsunabhängigen Kontrollen geraten immer wieder auch Täter ins Visier der Ermittlungsbehörden. Diese können strafrechtlich verfolgt, verurteilt und an der Begehung weiterer Straftaten gehindert werden. Die Ermittlungserfolge der Polizei wirken sich zudem eventuell abschreckend auf andere Täter im Umfeld der verhafteten Personen aus. Die unmittelbare Folge wird also vermutlich ein Rückgang der Kriminalität sein. Mittel- und langfristig ist Racial Profiling jedoch kontraproduktiv. Dies hat mehrere Gründe:
Zum einen führen verdachtsunabhängige Kontrollen zwangsläufig dazu, dass auch unbescholtene Bürger ins Visier der Polizei geraten. Dies ist natürlich insbesondere der Fall, wenn Merkmale zur Verdachtsgewinnung herangezogen werden, die nach Augenschein nicht sicher bestimmbar sind (wie z.B. Nationalität oder Religionszugehörigkeit). Aber selbst wenn zum Beispiel das Merkmal Nationalität X erfüllt wird, ist damit natürlich keine Aussage über eine Täterschaft getroffen. Der Zusammenhang zwischen Nationalität und Täterschaft in unserem Beispiel stellt eine statistische Korrelation, aber selbstverständlich keinen Kausalzusammenhang dar. So lässt sich rechnerisch bestimmen, dass mit einem bestimmten Prozentsatz polizeilich registrierte Drogenhändler der Nationalität X angehören, aber die Aussage, jemand sei Drogenhändler, weil er der Nationalität X angehört oder gar die Aussage, weil jemand in der Nationalität X angehört, sei er Drogenhändler, ist selbstverständlich falsch. In der Folge werden also zahlreiche Unschuldige zu Unrecht von der Polizei angehalten und kontrolliert, was mittelfristig zu einem Vertrauensverlust in die Polizei führen wird.
Aus kriminalistischer Sicht erweist sich zum anderen ein weiteres Problem als folgenreich. Durch die Konzentration auf eine bestimmte Tätergruppierung (Nationalität X) werden andere Tätergruppierungen ignoriert. Hier ergibt sich das Problem einer selbsterfüllenden Prophezeiung, bei der ein Anfangsverdacht zu einem Ermittlungserfolg führt und in der Folge der bestätigte Verdacht zu einer Konzentration weiterer Ermittlungen führt. Mittel- und langfristig ist es plausibel anzunehmen, dass jetzt andere Tätergruppierungen ungehindert agieren können, da die Polizeikräfte gebunden sind und der Umfang des Drogenhandels insgesamt durch die polizeiliche Strategie eher zu- als abnimmt. Zudem wird die ursprünglich ins Visier gefasste Tätergruppierung ihren Modus Operandi an das polizeiliche Vorgehen anpassen, so dass auch hier anfängliche Ermittlungserfolge nicht dauerhaft Bestand haben werden.
Im Ergebnis erweist sich Racial Profiling aus kriminologischer Sicht also nicht als erfolgversprechend.
Rechtliche Einordnung von Racial Profiling
Die Praxis des Racial Profiling verstößt in Deutschland gegen das Diskriminierungsverbot und ist in allen Fällen verboten. In Artikel 3 Grundgesetz heißt es:
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Weiterführende Informationen und Quellen
- Amnesty International (o.J.). Racial/ Ethnic Profiling: Positionspapier zu menschenrechtswidrigen Personenkontrollen. Online verfügbar unter: http://www.grundrechte-kampagne.de/sites/default/files/Amnesty_Racial_Profiling_Positionspapier_1.pdf
- Bender, U. (2019). Die Definition von Racial Profiling und die Diskussion in Deutschland. In: Kugelmann, D. (Hrsg.) Polizei und Menschenrechte. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. S. 358-365.
- Cremer, H. (2010). Ein Grundgesetz ohne „Rasse“. Vorschlag für eine Änderung von Artikel 3 Grundgesetz. Policy Paper No. 16. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte. Verfügbar unter: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
- Cremer, H.; Töpfer. E. (2019) „Racial Profiling“ aus grund- und menschenrechtlicher Perspektive. In: Kugelmann, D. (Hrsg.) Polizei und Menschenrechte. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. S. 366-371.
- Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) (2007) Allgemeine Politische Empfehlung Nr. 11 von ECRI. Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung in der Polizeiarbeit. CRI (2007). 39 Deutsche Version. Straßburg. Online verfügbar unter: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n11/rec11-2007-39-deu.pdf
- European Union Agency for Fundamental Rights (2007). Ethnic Profiling Project – Technical tender specifications/ Terms of reference. Annex A.1 FRA2-2007-3200-T02.
- Harris, D. (2002) Profiles in Injustice: Why Racial Profiling cannot work. New York: The New Press.
- Herrnkind, M. (2014). „Filzen Sie die üblichen Verdächtigen!“ oder: Racial Profiling in Deutschland. Polizei & Wissenschaft 3/2014, S. 35-58. Online verfügbar unter: https://www.humanrights.ch/upload/pdf/160606_Racial_Profiling_FilzenSiedieueblichenVerdaechtigen.pdf
- Hunold, D. (2019) Racial Profiling aus empirisch-wissenschaftlicher Perspektive. In: Kugelmann, D. (Hrsg.) Polizei und Menschenrechte. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. S. 378-382.
- Schicht, G. (2013). Racial Profiling bei der Polizei in Deutschland – Bildungsbedarf? Beratungsresistenz? Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, Nr. 36, 2/13, S. 32-37. Online verfügbar unter: https://www.waxmann.com/index.php?id=zeitschriftendetails&no_cache=1&eID=download&id_artikel=ART101309&uid=frei
- Seckelmann, M. (2019). Ethnic/ Racial Profiling bei verdachtsunabhängigen Kontrollen? In: Kugelmann, D. (Hrsg.) Polizei und Menschenrechte. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. S. 342-357.
- Simon, J. (1988). The ideological effect of actuarial practices. Law and Society Review, 22, 771–800.
- Thompson, V. E. (2020, 27. April). Racial Profiling, institutioneller Rassismus und Interventionsmöglichkeiten. Kurzdossier Migration und Sicherheit. Bundeszentrale für politische Bildung. Online verfügbar unter: https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/308350/racial-profiling-institutioneller-rassismus-und-interventionsmoeglichkeiten
Video zum Thema
Video von Zeit.de Racial Profiling: Kontrollgrund: Hautfarbe
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von players.brightcove.net zu laden.