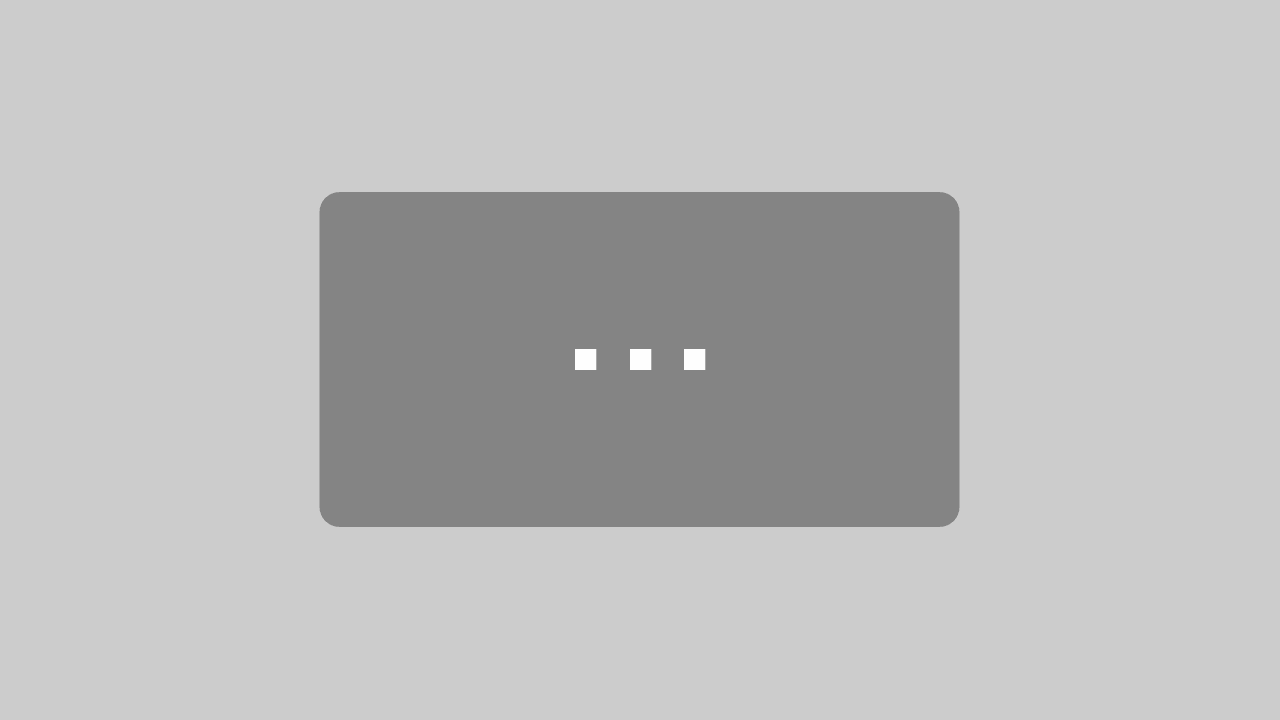VorurteilskriminalitätStraftaten, die aus Vorurteilen gegenüber bestimmten sozialen Gruppen begangen werden (auch: Hate Crime). oder vorurteilsgeleitete Kriminalität (oder auch englisch: Bias Crime) bezeichnet strafrechtlich relevante Handlungen, die zum Nachteil von Personen aufgrund derer Identität stiftenden Merkmale wie Geschlecht, Hautfarbe, nationale oder ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, sozialer Status usw. erfolgt. Die ebenfalls gebräuchliche und synonym verwendete Bezeichnung HasskriminalitätStraftaten, die sich gegen Personen oder Gruppen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen, ethnischen, religiösen oder sexuellen Gruppen richten und von Vorurteilen oder Hass motiviert sind. (englisch: Hate Crime) ist irreführend, da der Täter oder die Täterin mit der ViktimisierungDer Prozess der Opferwerdung durch eine Straftat oder ein anderes schädigendes Ereignis. einer konkreten Person auch die einschüchternde Signalwirkung auf andere Gruppenmitglieder, welche jene identifikationsstiftende Merkmale teilen, beabsichtigt.
Eine Definition von Vorurteilskriminalität lautet wie folgt:
Vorurteilskriminalität umfasst Straftaten, bei denen der Täter oder die Täterin das Opfer aufgrund dessen Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe auswählt. Die Gruppenzugehörigkeit des Opfers kann sich beispielsweise auf dessen ReligionSystem von Glaubensvorstellungen, Symbolen und Praktiken, das auf das Transzendente verweist und individuelle wie kollektive Sinngebung ermöglicht., Herkunft, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung beziehen. Bei diesen Straftaten, die in entscheidendem Maße von Vorurteilen gegenüber der Gruppe, der das Opfer aus Täter- oder Täterinnenperspektive zugeordnet wird, geleitet sind, beabsichtigt der Täter oder die Täterin die Schädigung der gesamten Gruppe des Opfers.
(Birkel at al., 2022, S. 50)
Die Charakteristika der Vorurteilskriminalität werden besonders deutlich anhand der Abgrenzung zu anderen Gewaltdelikten.
Abgrenzungskriterien von Vorurteilskriminalität zu anderen Gewaltdelikten:
- Bei Vorurteilskriminalität üben oftmals größere Täterinnen- und Tätergruppen GewaltGewalt bezeichnet die absichtliche Anwendung körperlicher oder psychischer Kraft zur Schädigung von Personen oder Dingen. auf einzelne Opfer aus.
- Täterinnen bzw. Täter und Opfer kennen sich meist nicht.
- Die Wahl der Waffen und die Brutalität sind extremer als bei anderen Taten, daher sind auch die direkten physischen Schäden des Opfers größer.
- Vorurteilskriminalität trifft häufiger dieselben Opfer mehrfach.
- Gleichzeitig bedingen die psychischen Folgen die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit eines Traumas, mit allen bekannten Befunden wie posttraumatischer Belastungsstörungen, Depressionen, Angst- und Panikstörungen, Vermeidungsreaktionen, Arbeitsunfähigkeit, Flashbacks oder Suchtkrankheiten.
- Auch werden das Eigentum und die für die Opfer wichtigen Plätze der Identifikation zerstört.
- Vorurteilskriminalität zielt auf die IdentitätIdentität bezeichnet das Selbstverständnis von Individuen in Bezug auf sich selbst und ihre soziale Umwelt. der Opfer ab. Sie sendet eine Botschaft und wirkt somit auch auf gesellschaftlicher Ebene innerhalb der gesamten Opfergruppe.
- Die Irrationalität, Unberechenbarkeit und Zufälligkeit der Taten verunsichert und ängstigt potentielle Opfer, beeinflusst deren Handlungen und tangiert somit Freiheitsrechte. Damit angesprochen ist die politische Dimension solcher Taten.
- Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass diese Opfergruppe eine hohe KriminalitätsfurchtDie individuelle und gesellschaftliche Angst vor kriminellen Handlungen. besitzt. Dies bezieht sich auf alle Formen der Kriminalitätsfurcht, d. h. auf ein geringeres raumbezogenes Sicherheitsgefühl, eine hohe persönliche Risikoeinschätzung und ein hohes Vermeidungs- und Schutzverhalten.
- Gleichzeitig ist die Anzeigequote der Opfer von Vorurteilskriminalität meist gering und das Vertrauen in die staatlichen Organe auch schwächer ausgeprägt als bei anderen Opfergruppen.
(Church & Coester, 2021, S. 5)
Beispiele für Straftaten aus dem Bereich der vorurteilsgeleiteten Kriminalität
Aus den oben genannten Kriterien wird ersichtlich, dass Vorurteilskriminalität einen großen und heterogenen Deliktsbereich umfasst. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen, sind nachstehend unterschiedliche vorurteilsmotivierte Straftaten aufgeführt:
- ausländerfeindlich motivierte Straftaten wie z.B. Beleidigungen, Körperverletzungen von mutmaßlich ausländischen Menschen aber auch Brandstiftungen in Asylbewerberunterkünften
- antisemitische, antiziganistisch motivierte Straftaten wie z.B. die Schändung eines jüdischen Friedhofes, das Beschmieren einer Synagoge mit Hakenkreuzen, die Beleidigung von Personen die mutmaßlich jüdischen Glaubens oder Roma sind
- Beleidigungen, Bedrohungen, üble Nachrede oder Körperverletzungen zum Nachteil von Frauen; wobei hier ein Hass auf Frauen allgemein motivstiftend ist, wie es beispielsweise bei Tätern, die der sog. Incel-Subkultur zugerechnet werden, der Fall ist
- Straftaten, die gegen homosexuelle oder trans Menschen gerichtet sind und einer homo- bzw. transphoben Haltung entspringen
- Straftaten, die sich gegen wohnungslose Menschen richten wie z.B. das in Brand setzen einer Schlafstätte, das Bespucken oder Urinieren auf schlafende Obdachlose
- Beleidigungen, Körperverletzungen, Raubdelikte zu Lasten von Menschen mit Behinderungen
Vorurteilskriminalität im Hell- und Dunkelfeld der Kriminalitätsstatistiken
Eine statistische Erfassung der Fälle von Vorurteilskriminalität im polizeilichen Hellfeld erfolgt im Kontext der politisch motivierten KriminalitätKriminalität bezeichnet gesellschaftlich normierte Handlungen, die gegen das Strafgesetz verstoßen. (PMK). Hierbei wird differenziert, ob der Tat eine politisch links- oder rechtsideologische Haltung zugrunde liegt bzw. durch eine ausländische oder religiöse Ideologie motiviert ist. Die folgende Zeitreihe zeigt die Entwicklung der polizeilich erfassten „Hasskriminalität“ über die letzten zwanzig Jahre. Es wird dabei deutlich, dass die erfassten Straftaten mehrheitlich dem politisch rechten Spektrum zugeordnet werden können. Insofern verwundert es auch nicht, dass die Fallzahlen ab dem Berichtsjahr 2015 – und damit zeitgleich zum Zuzug zahlreicher Flüchtlinge nach Deutschland – stark angestiegen sind (vgl. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 2022) [Die Gesamtzahl der PMK-Delikte für die Jahre 2013 und 2014 ist in der Originalquelle falsch angegeben. Die Zahlen sind in der unten stehenden Tabelle korrigiert.].
| Hasskriminalität | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMK -links- | 125 | 363 | 60 | 43 | 89 | 130 | 192 | 127 | 188 | 102 | 162 | 70 | 57 | 94 | 96 | 75 | 44 | 77 | 129 | 146 | 248 |
| PMK -rechts- | 4.927 | 4.289 | 3.528 | 3.773 | 3.988 | 4.813 | 4.295 | 4.358 | 3.981 | 3.305 | 3.554 | 4.112 | 4.305 | 4.983 | 9.426 | 9.696 | 7.170 | 7.153 | 7.491 | 8.901 | 8.408 |
| PMK -Ausländer- | 100 | 154 | 95 | 88 | 78 | 173 | 121 | 112 | 179 | 120 | 98 | 120 | 120 | 402 | 331 | 404 | |||||
| -ausländische IdeologieIdeologie bezeichnet ein System von Vorstellungen, Werten und Deutungen, das gesellschaftliche Verhältnisse erklärt, legitimiert oder kritisiert und dabei häufig Macht- und Herrschaftsverhältnisse stabilisiert.- | 132 | 232 | 192 | 176 | 225 | ||||||||||||||||
| -religiöse Ideologie- | 221 | 184 | 144 | 173 | 181 | ||||||||||||||||
| PMK -nicht zugeordnet- | 224 | 207 | 167 | 210 | 159 | 237 | 185 | 160 | 235 | 243 | 226 | 212 | 265 | 379 | 520 | 576 | 346 | 467 | 629 | 844 | 1.409 |
| PMK Gesamt | 5.376 | 5.013 | 3.850 | 4.114 | 4.314 | 5.353 | 4.793 | 4.757 | 4.583 | 3.770 | 4.040 | 4.514 | 4.647 | 5.858 | 10.373 | 10.751 | 7.913 | 8.113 | 8.585 | 10.240 | 10.501 |
Für das Berichtsjahr 2022 registrierte das BKA (2023, S. 10) 11.520 Fälle, was im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 9,7 % bedeutet.
Entwicklung der politisch motivierten Straftaten im Oberthemenfeld „Hasskriminalität“ im Vergleich Berichtszeitraum zu Vorjahr (2022 zu 2021)
| Themenfeld/ Jahr | 2022 | 2021 | in % |
|---|---|---|---|
| Antisemitisch | 2641 | 3.027 | - 12,75 % |
| Antiziganistisch | 145 | 109 | + 33,03 % |
| Ausländerfeindlich | 5372 | 4.735 | + 13,45 % |
| Behinderung | 88 | 118 | - 25,42 % |
| Christenfeindlich | 135 | 109 | + 23,85 % |
| Deutschfeindlich | 340 | 209 | + 62,68 % |
| Frauenfeindlich | 206 | – | – |
| Fremdenfeindlich | 10038 | 9.236 | + 8,68 % |
| Geschlecht/Sex. Identität | – | 340 | – |
| Geschlechtsbez. Diversität | 417 | – | – |
| Gesellschaftlicher StatusStatus bezeichnet die soziale Position einer Person innerhalb einer Gruppe oder Gesellschaft, die mit bestimmten Erwartungen, Rechten und Pflichten verbunden ist. | 149 | 150 | - 0,67 % |
| Hasskriminalität | 195 | 212 | + 8,02 % |
| Islamfeindlich | 610 | 732 | - 16,67 % |
| Männerfeindlich | 15 | – | – |
| RassismusRassismus bezeichnet die Diskriminierung, Abwertung oder Benachteiligung von Menschen aufgrund zugeschriebener „rassischer“ oder ethnischer Merkmale. | 3180 | 2.7.82 | + 14,31 % |
| Sexuelle Orientierung | 1005 | 870 | + 15,52 % |
| Sonstige ethn. Zugehörigkeit | 98 | 81 | + 20,99 % |
| Sonstige Religion | 35 | 38 | - 7,89 % |
| Gesamt | 11520 | 10.501 | + 9,70 % |
Die Erfassung der Vorurteilskriminalität im HellfeldDer Teil der Kriminalität, der polizeilich bekannt und in Statistiken wie der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst wird. unterliegt den üblichen Besonderheiten und Einschränkungen der statistischen Kriminalitätserfassung. Jedoch bestehen gerade bei der Erfassung von Hassverbrechen eine Reihe von besonderen Schwierigkeiten:
- Ein großer Anteil der Delikte betreffen leichtere Straftaten wie z.B. Beleidigungen. Es ist hier einerseits von einer geringen Anzeigebereitschaft der Opfer auszugehen und insofern von einem großen DunkelfeldDas Dunkelfeld umfasst alle Straftaten, die nicht polizeilich bekannt oder statistisch erfasst werden..
- Andererseits liegt nicht bei jedem Delikt mit Beteiligung einer Minderheitengruppe eine vorurteilsgeleitete Straftat vor.
- Die subjektiven Tatbestandsmerkmale sind nicht immer ersichtlich. Eine Zuordnung eines Gewaltdelikts zum Deliktsbereich der vorurteilsgeleiteten Kriminalität erfordert insofern eine Sensibilisierung der Fallbearbeiter voraus.
- Ob ein Delikt als sog. Hasskriminalität der PMK zugerechnet wird oder aber als ein „normales“ Delikt in die PKS einfließt, kann in Einzelfällen auch vom Arbeitsaufkommen/ Überlastungen einzelner Behörden und Sachbearbeiter abhängen.
Aufschlussreicher als die Zahlen zur vorurteilsgeleiteten Kriminalität im Bericht zur politisch motivierten Kriminalität sind Daten aus der DunkelfeldforschungDunkelfeldforschung beschreibt den wissenschaftlichen Versuch, nicht erfasste Straftaten und Opfererfahrungen sichtbar zu machen.. Eine Auswertung des repräsentativen Viktimisierungssurveys 2020 des Bundeskriminalamts und der Polizeien der Länder zeigt, dass die Prävalenzrate für vorurteilsgeleitete Körperverletzung innerhalb der letzten zwölf Monate bei einem Prozent liegt (Birkel et al., 2022). Es ist plausibel anzunehmen, dass leichtere Delikte wie etwa Beleidigungen sehr viel häufiger auftreten.
Die Herkunft, der soziale Status, die Religion und das Geschlecht/ die geschlechtliche Identität sind die vier Merkmale, die am häufigsten in Verbindung mit vorurteilsgeleiteter Körperverletzung gebracht werden.
Die Dunkelfeldbefragung zeigt ebenfalls, dass Männern doppelt so häufig Opfer vorurteilsgeleiteter Körperverletzungen werden wie Frauen. Die Prävalenzraten liegen bei 1,4 % bei Männern und 0,66 % bei Frauen. Die Höherbelastung von Männern gilt für alle erfassten Merkmale mit Ausnahme des Merkmals „Geschlecht, geschlechtliche Identität“. Bei diesem Merkmal berichten mehr als 5 von 1000 Frauen von einem Vorfall, jedoch nur 0,25 Männer pro 1000.
Mit Blick auf das Alter der Opfer vorurteilsgeleiteter Körperverletzungen lässt sich feststellen, dass jüngere Menschen (GruppeEine Gruppe ist eine soziale Einheit von mindestens zwei bzw. drei Personen, die durch gemeinsame Interaktionen, Ziele oder Zugehörigkeitsgefühle verbunden sind. der 18- bis 24-Jährigen gefolgt von der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen) am stärksten betroffen sind. Dieses Ergebnis ist insofern wenig überraschen, da jüngere Menschen grundsätzlich stärker von Körperverletzungsdelikten betroffen sind als ältere Menschen.
Schließlich lässt der Viktimisierungssurvey 2020 noch Rückschlüsse auf den Zusammenhang von Viktimisierung und Migrationshintergrund der Opfer zu. Die Prävalenzraten liegen für Menschen mit Migrationshintergrund je nach Ursprungsland zwischen 0,99 % und 3,09 %. Für Menschen ohne Migrationshintergrund liegt die Prävalenzrate indes bei 0,82 %.
Strafrechtliche und gesellschaftliche Relevanz von Vorurteilskriminalität
Vorurteilgeleitete Straftaten sind ein Konstrukt, das keine Entsprechung in einer einzelnen Strafrechtsnorm findet. So gibt es keinen eigenen Straftatbestand „Hasskriminalität“. Stattdessen werden strafbewehrte Handlungen wie etwa Beleidigungen, Verleumdungen, Bedrohungen, Diebstahls- oder Raubdelikte, Körperverletzungen usw. der Sammelkategorie Vorurteilskriminalität zugeordnet.
Diese Zuordnung setzt jedoch eine genaue Prüfung des subjektiven Tatbestands voraus. Das heißt, erst durch die Bewertung des Tatmotives und den Nachweis eines Tatvorsatzes lässt sich eine Tat eventuell als vorurteilsgeleitet identifizieren. Dies wiederum setzt jedoch Erfahrung, Umsichtigkeit und Gründlichkeit bei den polizeilichen Ermittlungen voraus. Strafrechtlich ist die Prüfung des subjektiven Tatbestands hier insbesondere mit Blick auf die Schwere der Schuld relevant. So werden in § 46 StGB (Grundsätze der Strafzumessung), Absatz 2 ausdrücklich „rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische oder sonstige menschenverachtende“ Beweggründe und Ziele des Täters genannt, die sich auf eine Strafzumessung auswirken.
Neben diesen strafrechtlichen Folgen sind vorurteilsgeleitete Straftaten aber auch gesellschaftlich von besonderer Relevanz. Zum einen ist hier natürlich an die direkte physische, psychische Schädigung und etwaige materielle Folgen für das direkte Opfer zu denken. Im Gegensatz zu den meisten anderen Straftaten geht die Schädigung jedoch über das direkte Opfer hinaus. Durch den Botschaftscharakter der Tat sind auch die gruppenbezogenen Folgen zu berücksichtigen. Die von der Tat ausgehende Signalwirkung ist geeignet, andere Gruppenmitglieder zu verunsichern. Hierdurch können die Lebensqualität sowie das Vertrauen in andere Menschen und Institutionen sinken. Das Unsicherheitsgefühl kann sich auch in einer gesteigerten Kriminalitätsfurcht und wahrgenommenen Angsträumen ausdrücken. Ein Schutz- und Vermeideverhalten können hier wiederum die Folgen sein.
Über diesen Zusammenhang referieren Church und Coester ausführlich in dem unten verlinkten Video. Die Ausführungen beziehen sich auf eine Sonderauswertung des Deutschen Viktimisierungssurveys 2017.
Weiterführende Informationen
Video
Interview mit Prof. Dr. Eva Groß zum Thema Vorurteilskriminalität
Podcast
5 Minuten Kriminologie, Folge 39: Vorurteilskriminalität
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.
FRA
Die European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) stellt auf ihrem Internetauftritt umfangreiche Informationen zur (Bekämpfung von) Hasskriminalität im internationalen Vergleich zur Verfügung: European Union Agency for Fundamental Rights.
Literatur
- Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (Hrsg.) (2010). Für eine effektivere Polizeiarbeit. Diskriminierendes „Ethnic Profiling“ erkennen und vermeiden: ein Handbuch. Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union.
- Birkel, C.; Church, D.; Erdmann, A.; Hager, A. & Leitgöb-Guzy, N. (2022). Sicherheit und Kriminalität in Deutschland – SKiD 2020. Bundesweite Kernbefunde des Viktimisierungssurvey des Bundeskriminalamts und der Polizeien der Länder. Wiesbaden: Bundeskriminalamt. Online verfügbar unter: https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/Forschungsergebnisse/SKiD2020_Ergebnisse_V1.2.pdf?__blob=publicationFile&v=20
- Bundeskriminalamt (2023, 21. April). Politisch motivierte Kriminalität im Jahr 2022. Bundesweite Fallzahlen. Online verfügbar unter: https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/PMK/2022PMKFallzahlen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
- Bundeskriminalamt (2022, 10. Mai). Politisch motivierte Kriminalität im Jahr 2021. Bundesweite Fallzahlen. Online verfügbar unter: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/2022/pmk2021-factsheets.pdf?__blob=publicationFile&v=2
- Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2022, 22. April). Übersicht „Hasskriminalität“: Entwicklung der Fallzahlen 2001 – 2021. Online verfügbar unter: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/2022/pmk2021-fallzahlen-hasskriminalitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=2
- Chakraborti, N. & Garland, J. (2015). Hate Crime. Impact, Causes & Responses (2. Aufl.). Los Angeles u.a.: Sage.
- Church, D. & Coester, M. (2021). Opfer von Vorurteilskriminalität. Thematische Auswertung des Deutschen Viktimisierungssurvey 2017. Aktuelles aus der kriminalistisch-kriminologischen Forschung 2021/ 4. Wiesbaden. Bundeskriminalamt. Online verfügbar unter: https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/Forschungsergebnisse/2021KKFAktuell_OpferVorurteilskriminalitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=3
- Coester, M. (2017). Das Konzept der Vorurteilskriminalität und Folgen für die polizeiliche Praxis. In: Christoph Kopke, Wolfgang Kühnel (Hrsg.). Demokratie, Freiheit und Sicherheit: Festschrift zum 65. Geburtstag von Hans-Gerd Jaschke. HWR Berlin Forschung, Band 63. Baden-Baden: Nomos.
- Groß, E. & Häfele, J. (2021). Vorurteilskriminalität. Konzepte, Probleme und Befunde der polizeilichen Erfassung. In: B. Schellenberg. & B. Frevel (Hrsg.). Rassismus und Rechtsextremismusbekämpfung als Arbeitsfelder der Polizei: Ermittlungsarbeit und Opferschutz. Forum Politische Bildung und Polizei (Heft 1/2021). S. 20-30.
- Lang, K. (2015). Vorurteilskriminalität. Eine Untersuchung vorurteilsmotivierter Taten im Strafrecht und deren Verfolgung durch Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte. Baden-Baden: Nomos.
- Schellenberg, B. (2012). Strategien gegen Rechtsextremismus und Vorurteilskriminalität – Für Pluralismus und liberale Demokratie in Deutschland. In: Manuela Glaab & Karl-Rudolf Korte (Hrsg.). Angewandte Politikforschung (S. 419–429). Wiesbaden: Springer.
- Schellenberg, B. & Frevel, B. (Hrsg.) (2021). Rassismus und Rechtsextremismusbekämpfung als Arbeitsfelder der Polizei: Ermittlungsarbeit und Opferschutz. Forum Politische Bildung und Polizei (Heft 1/2021).
- Schellenberg, B. & Frevel, B. (Hrsg.) (2021). Rassismus und Rechtsextremismusbekämpfung als Arbeitsfelder der Polizei: Aus- und Fortbildung. Forum Politische Bildung und Polizei (Heft 2/2021).