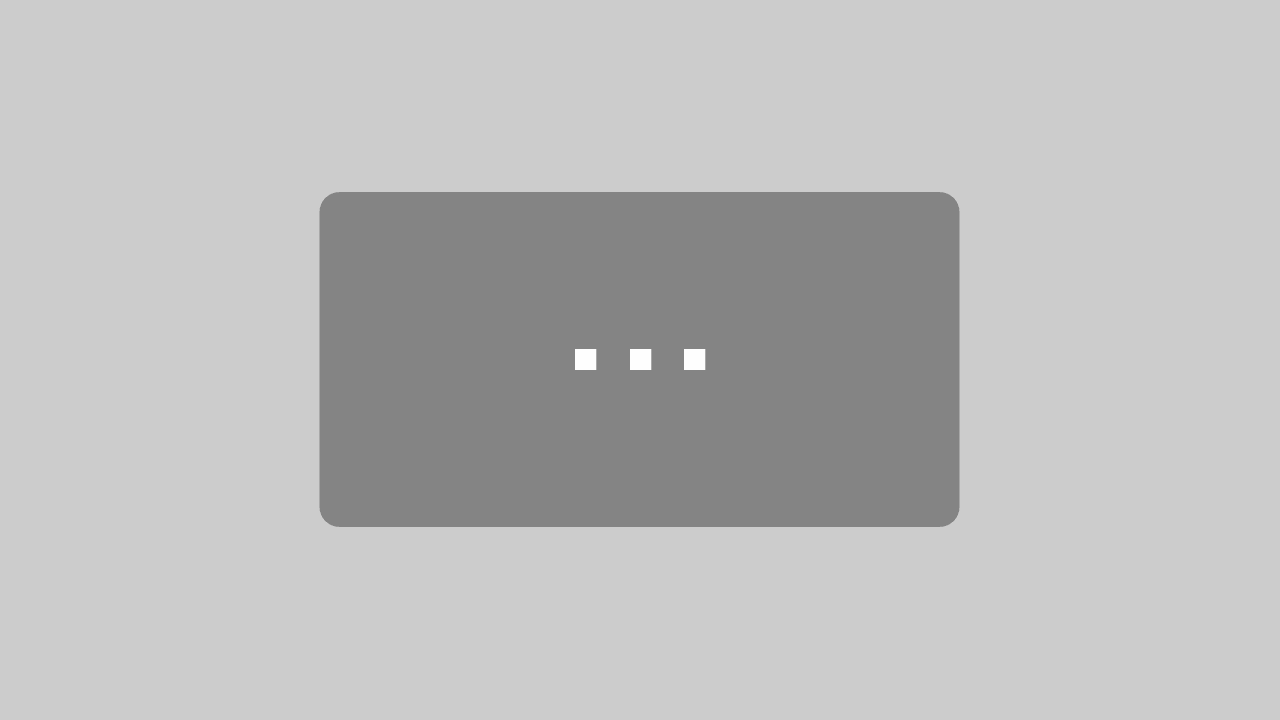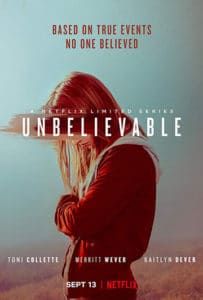Die Viktimologie ist ein Teilbereich der Kriminologie, der erst in der Nachkriegszeit langsam an Bedeutung gewonnen hat. Zuvor wurde den Opfern von Straftaten seitens der Kriminologie, aber auch den Organen der Strafverfolgung keine besondere Beachtung geschenkt; die Tat und Täterschaft standen im Vordergrund. Die „Entdeckung“ des Opfers geht auch auf kriminologische Forschungsaktivitäten zurück: Ende der 1960er Jahre fanden im Rahmen großangelegter Studien in den USA (im Zuge der „President’s crime Commission“ 1967) Opferbefragungen statt, die Erkenntnisse zu Opfererfahrungen, deren Verteilung, Schäden und Konsequenzen (Kriminalitätsfurcht, Verhaltensanpassung, Risikogruppen) zutage brachten.
In den folgenden Jahrzehnten wurde das Opfer als „vergessene Partei im Strafjustizsystem“ entdeckt und eine Opferbewegung entstand, die sich den Belangen von Kriminalitätsopfern annahmen (z.B. Frauenhäuser, der Weiße Ring, Sorgentelefone).
Heutzutage spielt die Viktimologie eine wichtige Rolle innerhalb der Kriminologie und ist insbesondere im Kontext der Kriminalprävention ein entscheidender Baustein.
Viktimologie (aus dem Lateinischen von „victima“ = Opfer) ist die Lehre vom Opfer. Diese Teildisziplin der Kriminologie befasst sich mit dem Prozess der Opferwerdung, dem Verhältnis von Opfer und Täter, dem Anzeigeverhalten, der Stellung des Opfers im Strafverfahren und dem Opferschutz.
Opferbegriff – Wer zählt als Opfer im Sinne der Viktimologie?
Der Begriff des Opfers ist keineswegs so eindeutig, wie er auf den ersten Blick erscheinen mag. Ausschlaggebend für die Charakterisierung eines Opfers ist zunächst ein entstandener Schaden. Dieser mag materiell sein oder in Form einer psychischen oder physischen Schädigung eingetreten sein. Geschädigter kann eine natürliche oder auch eine juristische Person sein. Diese „definitorischen Eckpfeiler“ decken die Mehrzahl der Opfer von Straftaten ab (z.B. jmd. wird durch eine Körperverletzung physisch geschädigt und erleidet zudem eine psychische Schädigung, die sich in einer Traumatisierung und einer gesteigerten Kriminalitätsfurcht äußert). Jedoch stößt diese Definition an ihre Grenzen, wenn wir an opferlose Verbrechen wie z.B. Umweltvergehen denken (z.B. ein Ölfrachter verklappt Altöl in der Nordsee). Wer gilt hier als Opfer? – die Umwelt, Nordseefischer, Strandurlauber, die Gesellschaft als Ganzes? Den Eintritt eines Schadens als qualifizierendes Merkmal zu erheben bringt weitere Probleme mit sich. So erscheint es nicht angebracht, Opfer eines Brandschadens ihre Opferrolle abzusprechen, wenn der Schaden auf eine Naturkatastrophe und nicht auf eine absichtliche Brandstiftung zurückzuführen ist.
Zudem sind Fälle denkbar, in denen Personen geschädigt werden, ohne dass sie unmittelbar Opfer einer Straftat wurden. Man denke hier z.B. an die Angehörigen und Freunde eines schwer geschädigten oder verstorbenen Opfers oder an traumatisierte Zeugen dieser Tat. Aber auch ein Ladendiebstahl kann neben dem Ladengeschäft als direkt Geschädigtem, weitere Opfer auf Seiten der Kunden produzieren, die von zukünftig höheren Preisen zur Kompensation des Verlustes negativ betroffen sind. Opfer können demnach auch Gruppen sein (z.B. alle Kunden von Ladenschaft X oder z.B. ethnische Minoritäten als Opfer einer Diskriminierung).
Der „offizielle“ Opferstatus wird erst im Strafverfahren verbindlich festgestellt. Bis dahin bleibt es bei einer Selbst- und Fremdzuschreibung. Man spricht in der Kriminologie zwar sehr wohl von einem Tatverdächtigen, nicht jedoch von einem Opferverdächtigen. D.h., eine empfundene Schädigung kann unabhängig von einer späteren juristischen Würdigung des Opferstatus sein. Jemand kann sich also sehr wohl als Opfer fühlen, ohne dass dies juristisch gewürdigt würde, aber auch der umgekehrte Fall ist vorstellbar, dass jemand die Opferrolle ablehnt – obwohl sie juristisch eindeutig vorliegen mag.
Aus den knappen Ausführungen wird bereits ersichtlich, dass sich in dieser Weise der Opferbegriff fast beliebig auf natürliche Personen, Gruppen und juristische Personen ausweiten lassen, die Opfer struktureller Gewalt, sozialer Ungleichheit, Diskriminierungserfahrungen, Naturkatastrophen usw. werden. Tatsächlich herrscht in der Kriminologie kein Konsens darüber, wie eng oder weit der Opferbegriff zu fassen ist. An dieser Stelle möchte ich jedoch – trotz aller unbefriedigenden Einschränkungen – dafür plädieren, Opfer im Sinne der Viktimologie mit Kriminalitätsopfern gleichzusetzen.
Im Runderlass des nordrhein-westfälischen Innenministeriums zum Polizeilichen Opferschutz wird der Opferbegriff folgendermaßen definiert:
Definition
Opfer ist, wer durch eine Straftat oder ein Ereignis unmittelbar oder mittelbar physisch, psychisch, sozial oder materiell geschädigt wurde. Mittelbar Geschädigte können Angehörige oder Hinterbliebene sowie Zeugen und Ersthelfer sein.
(Polizeilicher Opferschutz. Runderlass des Ministeriums des Innern (NRW) – 62.02.01 – vom 1. April 2019.)
Vergleichbar, aber enger ist die Definition von Opfer in der PKS gefasst. Hier heißt es:
Definition
Opfer sind natürliche Personen, gegen die sich die mit Strafe bedrohte Handlung unmittelbar richtete.
Opfer sind Geschädigte/unmittelbar Betroffene speziell definierter Delikte gegen höchstpersönliche Rechtsgüter (Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Ehre, sexuelle Selbstbestimmung) und Widerstandsdelikte, soweit diese im Straftatenkatalog zur Opfererfassung („O“) gekennzeichnet sind.
(Bundesministerium des Innern und für Heimat, 2022, S. 44).
Viktimisierung
Definition
Der Begriff ‚Viktimisierung‘ wird in der kriminologischen Terminologie genutzt, um den Prozess des ‚Zum-Opfer-Werdens‘ bzw. ‚Zum-Opfer-Machens‘ (vgl. Schneider 1975, S. 15) zu erfassen und beschreibt damit die unmittelbaren opferorientierten Ursachen und Wirkungen der Straftat (primäre Viktimisierung) einerseits sowie die indirekten Folgen der Straftat für das Opfer im Zusammenhang mit der Beziehung zwischen dem Opfer und seinem sozialen Umfeld bzw. den Instanzen sozialer Kontrolle andererseits (sekundäre, tertiäre Viktimisierung).
krimlex.de, Stichwort „Viktimisierung“
Viktimisierung bezeichnet die Opfer-Werdung. Es kann zwischen einer primären, sekundären und tertiären Viktimisierung unterschieden werden.
Primäre Viktimisierung
Die primäre Viktmisierung erfolgt durch die Schädigung einer Person durch eine Straftat. Diese Viktimisierung hinterlässt einen materiellen, physischen oder auch psychischen Schaden beim Opfer.
Sekundäre Viktimisierung
Die sekundäre Viktimisierung (auch als zweite Opferwerdung bezeichnet) kann als erweiterte Folge einer primären Viktimisierung auftreten. Ursächlich für die sekundäre Viktimisierung sind die Reaktionen des sozialen Umfeldes, der formellen Instanzen der sozialen Kontrollen oder auch der Medien auf die primäre Opferwerdung. Fühlt sich ein Kriminalitätsopfer nicht ernst genommen oder bleiben seine Bedürfnisse infolge der Opferwerdung unerfüllt, kann eine sekundäre Viktimisierung die Folge sein. Als eine extreme Reaktion auf eine Viktimisierung, die Ursache einer sekundären Viktimisierung sein kann, ist die sog. „Täter-Opfer-Umkehr“ (englisch: blaming the victim) zu nennen. Hierbei wird dem Opfer die Schuld für die Tat zugewiesen (also beispielsweise dem Opfer einer Sexualstraftat vorgeworfen, es hätte den Täter durch seinen Kleidungsstil, laszive Blicke o.ä. zu der Tat erst motiviert).
Tertiäre Viktiminsierung
Eine tertiäre Viktimisierung kann schließlich als eine Folge aus der primären und der sekundären Viktimisierung erfolgen. Die erfahrende Hilflosigkeit kann zu einer Verfestigung der Opferrolle führen und schlimmstenfalls zu einer fortdauernden „Opferkarriere“ führen. Eine wiederholte Opferwerdung steht oft mit einer erlernten Hilflosigkeit in Zusammenhang. Diese geht auf die Erfahrung der betroffenen Personen zurück, auch durch überlegtes und gezieltes Verhalten die negativen Wirkungen oder das Entstehen einer Opfersituation nicht verhindern zu können. Die Verinnerlichung dieser Haltung kann zu einer Passivität bei drohenden Gefahren (z.B. häusliche Gewalt) führen. Eine derartige Passivität bei drohenden Gefahren ist auch häufig bei Minderheiten und randständigen Gruppen (z.B. Obdachlosen, Drogenabhängigen) vorzufinden, die sich wiederholt macht- und hilflos Opfersituationen ausgesetzt gesehen haben.
Filmtipp 1
Die Dokumentation „Vergewaltigt – Wie sich Frauen zurück ins Leben kämpfen“ (WDR, 2018) zeigt eindrücklich die Folgen der sekundären Viktimisierung von Vergewaltigungsopfern.
Wie die Kampagne #metoo zeigt, sind es erschreckend viele Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Die bisherige Debatte über Abhängigkeit und Macht reicht aber nicht aus. Es fehlen Strukturen, die es Frauen nach einem solchen Verbrechen leichter machen, Anzeige zu erstatten. Denn: Nur 15 Prozent der Opfer von sexueller Gewalt gehen zur Polizei, so eine EU-Studie von 2014. Viele Frauen haben Angst vor dem, was ihnen bei Behörden und vor Gericht widerfahren kann, wenn sie die Täter anzeigen. Die Doku erzählt die Geschichten von vier mutigen Frauen und dem, was sie nach der Anzeige erlebt haben. Der Film stellt die Frage, was sich in Deutschland für Opfer von sexueller Gewalt ändern muss. Ein Jahr nach dem ersten Film haben wir die Protagonistinnen wieder getroffen um zu sehen, wie es mit ihnen weiter gegangen ist. Den Film gibt’s hier: https://www.youtube.com/watch?v=44tnLjRoKkc&t=0s
Filmtipp 2: Unbelievable (2019)
Die von Netflix produzierte Mini-Serie „Unbelievable“ beruht auf einer wahren Begebenheit und erzählt die Geschichte einer Frau, die beschuldigt wird, sich ihre Vergewaltigung ausgedacht zu haben.
Die Qualität der Serie macht neben der eindrücklichen Darstellung vor allem aus, dass hier das genretypische Whodunit-Schema aufgebrochen wird und sich die Erzählung fast ausschließlich auf die Folgen der (sekundären) Viktimisierung der Vergewaltigungsopfer beschränkt.
Die Serie wurde für vier Golden Globes nominiert.
Opfertypologien
Situationsorientierte Erklärungsansätze
Viktimologie und Prävention
Vortrag von Prof. Dr. Hans-Jürgen Kerner zur Schnittmenge von Kriminologie, Viktimologie und Kriminalprävention – gehalten anlässlich des 18. Deutschen Präventionstags 2013
Opferschutz und Opferhilfe sind Kernaufgaben der polizeilichen Arbeit
Opferschutzgesetzgebung
Weiterführende Informationen
- Bundesministerium des Innern und für Heimat (Hrsg.) (2022). Polizeiliche Kriminalstatistik 2021. Ausgewählte Zahlen im Überblick (V 1.0). Berlin. Online unter: https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/FachlicheBroschueren/IMK-Bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=3
- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2018, Juni) Opferfibel.Rechte von Verletzten und Geschädigten in Strafverfahren. Berlin. Online verfügbar unter: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Opferfibel.pdf?__blob=publicationFile&v=15
- Guzy, N.; Birkel, C.; Mischkowitz, R. (Hrsg.) (2015) Viktimisierungsbefragungen in Deutschland. Band 1: Ziele, Nutzen und Forschungsstand. [Polizei + Forschung: Band 47.1, herausgegeben vom Bundeskriminalamt, Kriminalistisches Institut]. Wiesbaden: Bundeskriminalamt. Online verfügbar unter: https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/PolizeiUndForschung/1_47_1_ViktimisierungsbefragungenInDeutschland.html?nn=47924
- Guzy, N.; Birkel, C.; Mischkowitz, R. (Hrsg.) (2015) Viktimisierungsbefragungen in Deutschland. Band 2: Methodik und Methodologie. [Polizei + Forschung: Band 47.2, herausgegeben vom Bundeskriminalamt, Kriminalistisches Institut]. Wiesbaden: Bundeskriminalamt. Online verfügbar unter: https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/PolizeiUndForschung/1_47_2_ViktimisierungsbefragungenInDeutschland.html
- Polizei Nordrhein-Westfalen – Polizeilicher Opferschutz. Online unter: https://polizei.nrw/polizeilicher-opferschutz-1
- Polizeilicher Opferschutz. Runderlass des Ministeriums des Innern (NRW) – 62.02.01 – vom 1. April 2019. Online unter: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=2&ugl_nr=2051&bes_id=40425&val=40425&ver=7&sg=1&aufgehoben=N&menu=1
- Schneider, H J (1975) Viktimologie: Wissenschaft vom Verbrechensopfer. Tübingen: Mohr.
- World Society of Victimology