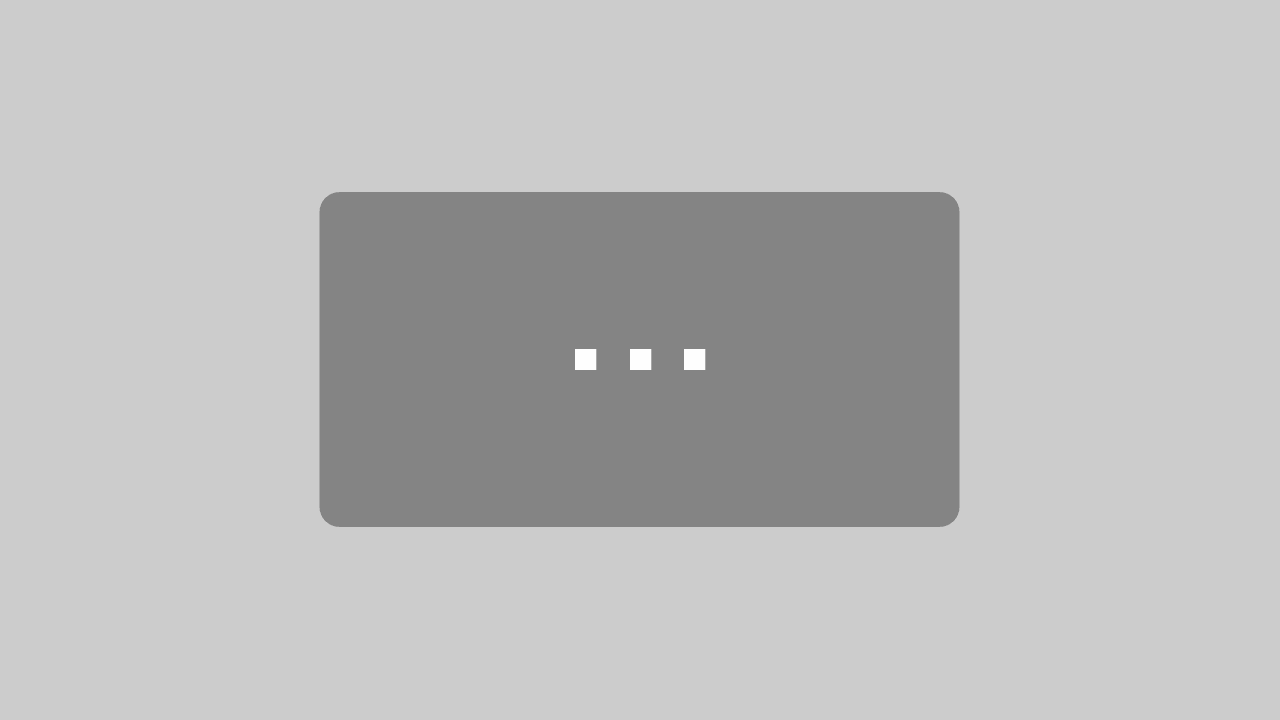Die Narrative Criminology ist ein vergleichsweise junger kriminologischer Zugang, der sich mit den Geschichten über Kriminalität befasst: Geschichten, die Menschen sich selbst und anderen erzählen, um ihr (abweichendes) Verhalten zu erklären, zu rechtfertigen oder überhaupt erst zu ermöglichen. Im Zentrum steht dabei nicht die objektive Tat, sondern ihre subjektive (Be-)Deutung. Die Narrative Criminology versteht Kriminalität als erzählerische Konstruktion von Wirklichkeit, Identität und Devianz. Sie ist eng verwandt mit der Cultural Criminology und dem Symbolischen Interaktionismus.
Merkzettel
Narrative Criminology
Hauptvertreter:innen: Lois Presser, Sveinung Sandberg
Erstveröffentlichung: 2015 (Presser & Sandberg, Narrative Criminology: Understanding Stories of Crime)
Land: USA und Norwegen
Idee/ Annahme: Kriminalität ist nicht nur Handlung, sondern auch Erzählung. Menschen erzählen Geschichten über sich selbst, ihre Taten und ihre Welt – und diese Narrative ermöglichen, rechtfertigen oder verhindern Devianz. Kriminalität wird so als narrativ strukturierter Sinnzusammenhang verstanden.
Abgrenzungen zu: Im Gegensatz zu strukturell orientierten Ansätzen (z. B. Anomietheorie) oder rationalistischen Modellen (Rational Choice) rückt die Narrative Criminology subjektive Bedeutungszuschreibungen und kulturelle Deutungsmuster in den Mittelpunkt. Sie erweitert klassische Konzepte wie die Neutralisierungstechniken um die Frage, wie durch Narrative Sinn erzeugt und Identität konstruiert wird.
Entstehungskontext
Die Narrative Criminology entwickelte sich seit den 2010er Jahren als Reaktion auf die zunehmende Anerkennung der Bedeutung subjektiver Wahrnehmungen und kultureller Deutungen in der Kriminologie. Sie baut auf dem Labeling Approach und der Cultural Criminology auf, geht jedoch einen Schritt weiter: Nicht nur die Zuschreibung von Devianz, sondern auch die Selbstdeutung der Täter:innen wird in den Blick genommen. Zentral ist dabei das Werk Narrative Criminology: Understanding Stories of Crime von Lois Presser und Sveinung Sandberg (2015), das dem neuen Forschungsfeld seinen Namen gab.
Theorie
Die Narrative Criminology untersucht, welche Geschichten Menschen über ihre Taten erzählen, und wie diese Geschichten mit ihrer sozialen Identität, ihrer Lebenslage und ihren kulturellen Kontexten verknüpft sind. Sie versteht Narrative als „discursive actions“, also als sprachliche Handlungen, die nicht nur beschreiben, sondern auch soziale Wirklichkeit herstellen.
Dieser Ansatz ist dem Paradigma der verstehenden Soziologie verpflichtet, wie es Max Weber geprägt hat: Nicht die objektive Tat, sondern der subjektive Sinn steht im Zentrum der Analyse. Kriminalität wird als sinnhafte, sozial eingebettete Handlung verstanden, deren Deutung durch Erzählungen strukturiert ist. Wie Menschen ihr abweichendes Verhalten selbst verstehen und wie sie es anderen gegenüber rechtfertigen, ist daher zentraler Gegenstand der Analyse.
Presser und Sandberg argumentieren, dass Narrative eine ermöglichende Funktion für abweichendes Verhalten haben können: Menschen erzählen sich selbst Geschichten, in denen Devianz notwendig, heroisch oder unausweichlich erscheint. Ebenso können Narrative dazu dienen, Schuld zu leugnen, Verantwortung abzuschieben oder sich selbst als Opfer zu inszenieren.
In diesem Zusammenhang knüpft die Narrative Criminology direkt an die Theorie der Neutralisierungstechniken von Sykes und Matza (1957) an. Diese beschrieben, wie Täter:innen durch kognitive Mechanismen wie Schuldleugnung oder Schuldumkehr eine moralische Rechtfertigung für abweichendes Verhalten schaffen. Die Narrative Criminology erweitert diesen Ansatz, indem sie solche Mechanismen als Teil kohärenter Erzählmuster versteht – also nicht nur als spontane Techniken, sondern als kulturell verfügbare Narrative, die in sozialen Kontexten gelernt und weitergegeben werden.
Typische narrative Strukturen in devianzbezogenen Erzählungen sind z. B.:
- Der „notwendige Bruch“ mit einer ungerechten Ordnung
- Die Geschichte der Rebellion oder Emanzipation
- Das Narrativ des Scheiterns oder der Sucht
- Die Erzählung von Reue und Besserung
Wichtig ist: Narrative Criminology erhebt nicht den Anspruch, objektive Wahrheiten über Devianz zu liefern. Vielmehr geht es um die subjektive Bedeutung und um die Art und Weise, wie Menschen sich selbst in Bezug auf Kriminalität verstehen und positionieren.
Weitergedacht: Truman Capote, Gonzo-Journalismus und das Erzählen von Verbrechen
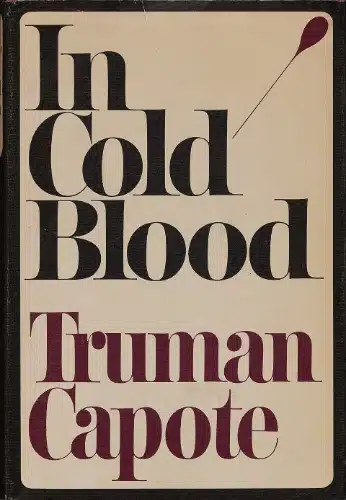
Auch der sogenannte Gonzo-Journalismus, wie ihn Hunter S. Thompson ab Ende der 1960er Jahre prägte, stellt ein Beispiel für narrative Grenzgänge dar. Statt objektiver Berichterstattung setzt Gonzo auf radikal subjektive Perspektiven, Selbstbeteiligung und stilistische Zuspitzung. In seinem Buch Hells Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs (1966) schildert Thompson seine Feldforschung aus dem Inneren der Szene – nicht als neutraler Beobachter, sondern als Mitreisender, Beobachteter und gelegentlich Beteiligter.
Jack Katz verweist in Seductions of Crime explizit auf Capotes Werk, um zu zeigen, wie moralische Erzählmuster (z. B. gefühlte Demütigung oder „righteous slaughter“) kriminelles Handeln strukturieren. Die Narrative Criminology knüpft daran an, indem sie solche Erzählungen nicht als literarisches Beiwerk, sondern als konstitutiven Bestandteil abweichenden Handelns versteht. Ob in Reportagen, Liedtexten oder Interviews: Narrative schaffen Bedeutung, ermöglichen Handlung und verleihen Devianz Struktur. Die Grenze zwischen Wirklichkeit und Darstellung verläuft dabei selten klar.
Kriminalpolitische Implikation
Die Narrative Criminology hat keine direkt normativen Ableitungen, wohl aber implizite kriminalpolitische Konsequenzen. Wenn Narrative als konstitutiv für kriminelles Verhalten verstanden werden, dann ergeben sich daraus wichtige Einsichten für die Strafzumessung, die Resozialisierung und die Delinquenzprävention.
- In der Resozialisierung können narrative Verfahren genutzt werden, um abweichende Selbstbilder zu bearbeiten („narrative turning points“).
- In der Arbeit mit Täter:innen eröffnet sich die Möglichkeit, durch Erzählungen alternative Identitäten zu stärken (z. B. im Rahmen von Restorative Justice).
- Auch die Analyse öffentlicher Diskurse über Kriminalität kann zeigen, wie populäre Narrative z. B. Stereotype über Tätergruppen verfestigen oder infrage stellen.
Kritische Würdigung und Aktualitätsbezug
Die Narrative Criminology bietet einen innovativen Zugang zur Erforschung von Devianz und bereichert die kriminologische Theorielandschaft. Ihre Stärken liegen in der qualitativen Tiefenerschließung von Lebensverläufen und der Konnektivität zu Cultural Studies, Biographieforschung und Medienanalyse.
Kritisch anzumerken ist, dass die Narrative Criminology bislang kaum quantitative Studien hervorgebracht hat und methodisch stark auf Interviewdaten und Textanalysen angewiesen ist. Zudem stellt sich die Frage, wie sich narrative Muster in strukturelle Machtverhältnisse einfügen – also: Wer darf wie erzählen? Wer wird gehört?
Gerade im Kontext von Musik (z. B. Rap), Podcasts, autobiographischer Literatur oder TikTok-Videos bietet die Narrative Criminology ein enormes Forschungspotenzial – etwa bei der Analyse von Opfererzählungen, Biographien von Intensivtätern oder polizeilichen Gegennarrativen.
Literatur
- Presser, L., & Sandberg, S. (Hrsg.). (2015). Narrative Criminology: Understanding Stories of Crime. New York: NYU Press.
- Sandberg, S. (2010). What can “Lies” tell us about life? Notes towards a framework of narrative criminology. Journal of Criminal Justice Education, 21(4), 447–465.
- Presser, L. (2009). The narratives of offenders. Theoretical Criminology, 13(2), 177–200.
- Presser, L. (2018). Inside Story: How Narratives Drive Mass Harm. University of California Press.
- Maruna, S. (2001). Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives. American Psychological Association.