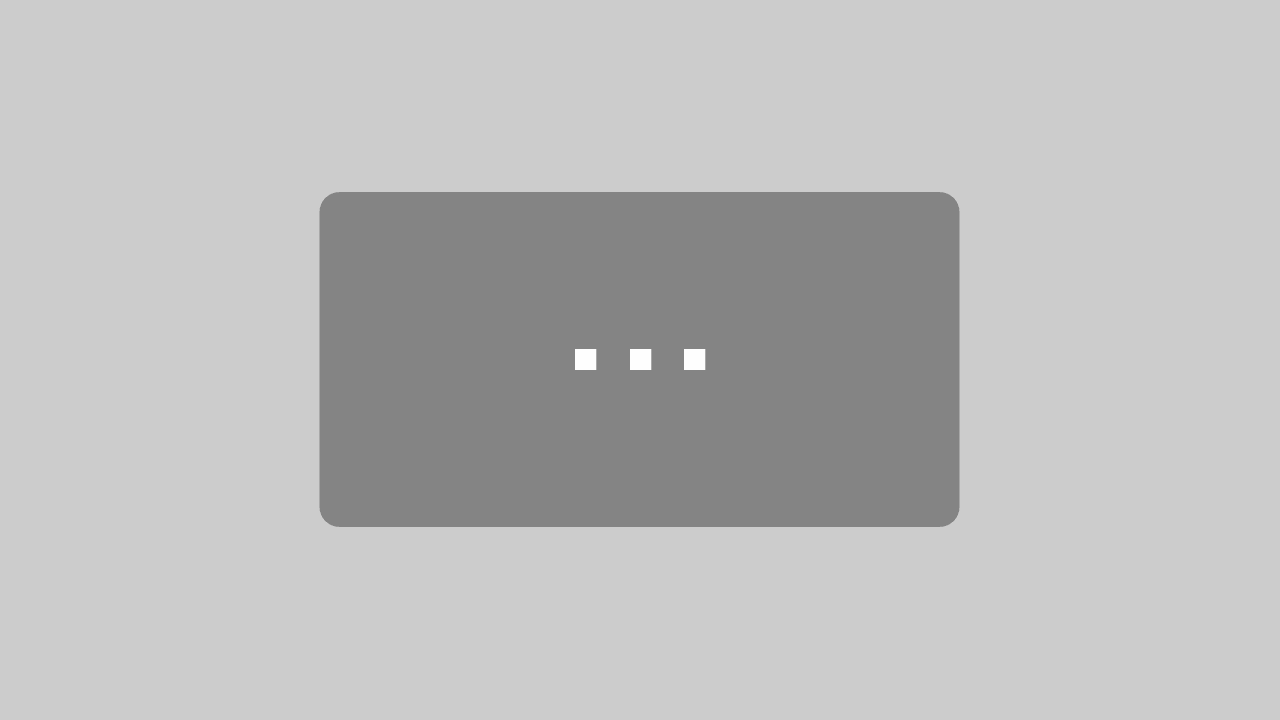Das Konzept der Cop Culture ist im deutschsprachigen Raum maßgeblich mit dem Namen Rafael Behr verbunden. Behr, ehemaliger Polizist aus Hessen, promovierter Soziologe und heute Professor für Kriminologie und Soziologie an der Akademie der Polizei in Hamburg, hat das ursprünglich aus dem englischsprachigen Raum stammende Konzept einer Polizistenkultur (vgl. Ianni & Ianni, 1972; Reuss-Ianni, 1983; Reiner, 2000) auf die deutsche Polizei übertragen. Die zahlreichen Publikationen zum Thema zählen heute zu den Standardwerken der Polizeiforschung (insbesondere: Behr 2006, 2008).
Das Konzept ist zunächst der Organisationssoziologie zuzuordnen. Speziell geht es um die Bestimmung einer Unternehmenskultur bei der Polizei und den wechselseitigen Einfluss von Strukturen, Prozessen und normativen Bezügen. Behr (2006, S. 48) definiert Polizeikultur wie folgt:
Polizeikultur ist ein Bündel von Wertbezügen, die als transzendentaler Rahmen das Alltagshandeln von Polizeibeamten ermöglichen, begrenzen und anleiten. Wertbezüge geben darüber Auskunft, in welchen Situationen welche Werte und Tugenden in welchem Ausmaß Geltung erlangen (z.B. Selbstdisziplin, Tapferkeit, Loyalität, Zivilcourage) und auch darüber, wann und in welchem Ausmaß Gewalt angewendet werden muss, soll oder darf.
Ausgehend von diesem allgemeinen Verständnis einer Polizeikultur, kann zwischen zwei verschiedenen Unternehmenskulturen innerhalb der Organisation der Polizei differenziert werden. Einer offiziellen Polizeikultur steht demnach eine informelle Polizistenkultur (oder eben Cop Culture) gegenüber.
Die Polizeikultur ist durch eine strikte Verfahrensförmigkeit gekennzeichnet. Sie orientiert sich an behördlichen Leitbildern, Erlassen und Gesetzen mit ihrer universellen Gültigkeit für alle Beschäftigten. In ihrer Wirkung ist die Polizeikultur nach außen gerichtet. Die Vermittlung dieser universellen Regeln erfolgt in der Regel schriftlich/ kognitiv – z.B. in Form der Ausbildung an den Polizeifachhochschulen, Öffentlichkeitsarbeit der polizeilichen Pressestellen, Arbeit in den Stabsstellen und der Polizeiführung. Die Polizeikultur bildet damit mit ihren Universalnormen den sog. „first code“ ab, der sich strikt an der Legalität polizeilichen Handelns orientiert. Die universelle Gültigkeit der Normen geht einher mit einem hohen Abstraktionsgrad, der eine Übertragbarkeit auf konkrete Einsatzszenarien und -situationen erschwert. Wenn beispielsweise ein Leitbild einer Polizeibehörde eine bürgernahe, kompetente und moderne Polizeiarbeit verspricht, ist hiermit keine Aussage darüber getroffen, wie diese Vorgabe umzusetzen ist.
An dieser Stelle zeigt sich der positive Nutzen einer informellen Cop Culture, die den „second code“ oder „das Konzentrat des polizeilichen Alltagswissens“ (Behr, 2018, S. 30) abbildet. Durch narrative Vermittlung werden praktische, situationsspezifische Handlungsanleitungen vermittelt (z.B. durch TutorInnen, Vorgesetzte, dienstältere KollegInnen, PraxistrainerInnen usw.). Diese subkulturellen Partikularnormen helfen, konkrete Einsatzsituationen zu bewerten und zu bewältigen.
Wie jede Kultur wirkt auch die Polizistenkultur identitätsstiftend, indem sie normative Bewertungsmuster bereitstellt. Dies birgt ein erhebliches Konfliktpotential, das in zweierlei Richtungen wirken kann. Eine erste Konfliktlinie ergibt sich innerhalb der Polizeiorganisation: Die Cop Culture der street cops und „handarbeitenden Polizisten“ steht der Polizeikultur entgegen. Aus Perspektive der praxisorientierten Cop Culture können die formalen Vorgaben der Führung als praxisfern und untauglich bewertet werden. Viele PolizeischülerInnen bekommen im Praktikum von dienstälteren Kollegen zu hören, dass sie alles, was sie in der Fachhochschule gelernt haben, vergessen können, da sie nun erfahren, wie wirkliche Polizeiarbeit funktioniere. Die Widersprüche zwischen Polizei- und Polizistenkultur sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:
Polizistenkultur vs. Polizeikultur
| Kriterium | Polizistenkultur | Polizeikultur |
|---|---|---|
| Hegemonie | expressive Männlichkeit, bes. Krieger-Männlichkeit | bürokratische Männlichkeit (Technokraten/ Verwalter |
| Vorherrschende Männlichkeit | street cop/ Schutzmann | Sachbearbeiter |
| Irritation/ Störung/ Abweichung | z.B. Homosexualität, falscher Idealismus („Verrat“), kritische Polizisten | kritische Polizisten, Krieger, Individualisten |
| Vermittlung | informell – narrativ – expressiv | formal – schriftlich – kognitiv |
| Normenbezug | subkulturelle Partikularnormen (Handlungsmuster), Gerechtigkeit | universelle Ethik (Leitbilder) |
| Wirkung auf Berufsrolle | Expressiv – nach innen (Selbstverständigung und Identifikation mit eigener Statusgruppe) | Instrumentell – nach außen (Verständigung mit Öffentlichkeit, Distanzierung von anderen Statusgrupen) |
| Stellung im Konflikt | betroffen, engagiert, erlebnisorientiert, oft: Partei | distanziert, rational, ergebnisorientiert, oft: Entscheidungsinstanz |
| Ressourcen | Erfahrung/ Praxis | Bildung/ Theorie |
| Organisationsteil | Linie/ Basis | Stäbe/ (Nähe zur) Organisationsleitung |
| Berufszufriedenheit/ Handlungsziel | Ergebnisorientierung | Verfahrensförmigkeit |
| berufsethische Bezüge (Tugenden) | Gerechtigkeit, Ehre, Solidarität, Schutz der Gemeinschaft, Sinn, Treue | Rechtlichkeit, Verfahrensförmigkeit, Zuverlässigkeit, Stetigkeit, Disziplin |
| Alltagserleben der Akteure | Disziplin, Routinen, Anpassung, Gehorsam, Fremdbestimmung | selbstbestimmte Pflichterfüllung |
(Behr, 2000, S. 23)
Cop Culture und Männlichkeit und Gewalt

By Daniel Schwen (Own work) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
Vortrag: Rafel Behr: „Ich hab‘ Polizei?“
Anfang 2021 hat Prof. Dr. Behr auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts Heidelberg (DAI) einen Vortrag zu Fremd- und Selbstbildern der deutschen Polizei gegeben. Der Vortrag ist auf YouTube verfügbar.
Selbst-, Fremd- und Feindbild demokratischer Sicherheitskräfte. „Linke Zecken“, „Anständige Bürger“, „bescheidene Helden“ – die Selbst- und Fremdzuschreibungen in der Polizei entstammen nicht immer der eigenen Erfahrung, sondern sind oft überlieferte Stereotype, die die Arbeit der „street cops“ anleiten. Welche Gründe gibt es für diese Selbst- und Fremdbilder – zwischen Idealisierung und Dämonisierung? Wie sehen PolizistInnen sich selbst und was wissen sie von ihrem Publikum? Auch die Gewalt von und an der Polizei spielt eine Rolle, denn sie ist oft nur ein wechselseitiger Ausdruck aggressiver Impulse.
Quellenverzeichnis
- Behr, R. (2018, 19. April). Polizei.Kultur.Gewalt.Polizeiarbeit in der „offenen Gesellschaft“. Lehr- und Studienbrief für Bachelor-und Masterstudiengänge der Polizei sowie für die Module „Policing“ im weiterbildenden Masterstudiengang Kriminologie am Institut für kriminologische Sozialforschung der Universität Hamburg und „Angewandte Polizeiwissenschaft“ des Masterstudiengangs „Kriminologie und Polizeiwissenschaft“ an der Universität Bochum. Akademie der Polizei Hamburg.
- Behr, R. (2018). »Die Polizei muss … an Robustheit deutlich zulegen«: Zur Renaissance aggressiver Maskulinität in der Polizei. In: Loick, D. (Hrsg.). Kritik der Polizei. Frankfurt/ New York: Campus. S. 165-178.
- Behr, R. (2000). Cop Culture und Polizeikultur. Von den Schwierigkeiten einer Corporate Identity der Polizei. In K. Liebl & T. Ohlemacher (Hrsg.): Empirische Polizeiforschung. Interdisziplinäre Perspektiven in einem sich entwickelnden Forschungsfeld. Herbolzheim: Centaurus-Verl.-Ges., S. 12-26.
- Behr, R. (2008). Cop Culture – Der Alltag des Gewaltmonopols. Männlichkeit, Handlungsmuster und Kultur in der Polizei. Wiesbaden: Springer.
- Behr, R. (2006). Polizeikultur. Routinen – Rituale – Reflexionen. Bausteine zu einer Theorie der Praxis der Polizei. Wiesbaden: Springer.
- Ianni, F.A.; Ianni, E.R. (1972). A Family Business. London: Routledge and Kegan Paul.
- Reiner, R. (2002). Cop Culture. In: Yvonne Jewkes & Gayle Letherby (Hrsg.) Criminology. A Reader.S. 276-287.London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.
- Reiner, R. (2000). The Politics of the Police (3. Aufl.). Oxford: Oxford University Press.
- Reuss-Ianni, E. (1983). Two Cultures of Policing: Street Cops and Management Cops. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publisher.