Studies in Ethnomethodology von Harold Garfinkel, erstmals 1967 veröffentlicht, ist das Schlüsselwerk der Ethnomethodologie. Es markiert einen radikalen Perspektivwechsel in der Soziologie: Weg von strukturellen Makromodellen hin zu einer feinen Analyse alltäglicher Interaktionen. Garfinkel untersucht, wie soziale Ordnung nicht vorausgesetzt, sondern in der konkreten Praxis der Menschen immer wieder neu hergestellt wird. Sein Werk bildet damit die Grundlage für zahlreiche weiterführende Forschungsrichtungen, von der Gesprächsanalyse bis zur kritischen Justizforschung.
Merkzettel
Harold Garfinkel – Studies in Ethnomethodology
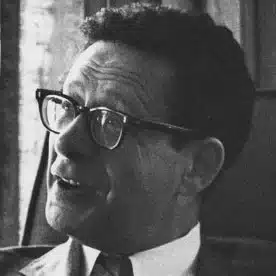
Hauptvertreter: Harold Garfinkel (1917–2011)
Erstveröffentlichung: 1967
Land: USA
Idee/Annahme: Soziale OrdnungStabile, strukturierte und vorhersehbare Muster sozialen Handelns in einer Gesellschaft. wird durch alltägliche Interaktionen (re)produziert
Grundlage für: Ethnomethodologie, Gesprächsanalyse, MikrosoziologieUntersuchung sozialer Interaktionen und kleiner sozialer Einheiten wie Familien, Gruppen oder Organisationen.
Verwandte Theorien: Goffman, Cicourel, Labeling ApproachTheorie der Kriminologie, die die Bedeutung gesellschaftlicher Zuschreibungsprozesse für die Entstehung von abweichendem Verhalten und Kriminalität betont., Phänomenologische Soziologie
Kernkonzepte der Ethnomethodologie
Garfinkel zeigt, dass soziale Ordnung kein gegebenes System ist, sondern ständig neu hergestellt wird – durch interpretatives Handeln, Hintergrundwissen und geteilte Erwartungen. Drei zentrale Konzepte stehen im Mittelpunkt seines Ansatzes:
Indexikalität
Der Begriff der Indexikalität beschreibt, dass die Bedeutung sprachlicher Äußerungen immer vom jeweiligen sozialen, räumlichen oder zeitlichen Kontext abhängt. Anders als in formalen Sprachen wie der Mathematik ist Bedeutung im Alltag nie vollständig eindeutig – sie ist „indexikal“, d.h. auf den Kontext bezogen. Menschen verstehen Aussagen nicht isoliert, sondern durch das Mitdenken gemeinsamer Hintergrundannahmen („background expectancies“).
Beispiel: Die Aussage „Es ist kalt hier“ kann – je nach Situation – eine Beschwerde, eine Bitte um das Schließen des Fensters oder lediglich eine Feststellung sein. Der soziale Kontext bestimmt die Interpretation.
Reflexivität
Reflexivität meint, dass soziale Handlungen nicht nur eine Bedeutung transportieren, sondern gleichzeitig die soziale Ordnung bestätigen oder herstellen, in der sie stattfinden. Akteur:innen handeln so, dass ihre Handlungen in den Sinnzusammenhang ihrer sozialen Welt passen – sie „spiegeln“ gewissermaßen diese Ordnung und stellen sie dadurch zugleich her.
Beispiel: Ein:e Lehrer:in beginnt den Unterricht mit einem förmlichen „Guten Morgen“. Diese Handlung erfüllt nicht nur eine Begrüßungsfunktion, sondern signalisiert zugleich den Beginn des institutionellen Rahmens „Unterricht“ – und macht damit soziale Ordnung erfahrbar.
Accountability
Das Konzept der Accountability beschreibt die Erwartung, dass soziales Verhalten erklärbar, begründbar und „normal“ erscheinen muss. Menschen handeln so, dass andere ihre Handlungen verstehen und als angemessen interpretieren können. Gleichzeitig sind sie jederzeit dazu angehalten, sich für ihr Verhalten rechtfertigen zu können. Accountability ist damit ein zentrales Bindeglied zwischen individuellem Handeln und sozialer Ordnung.
Beispiel: Wer sich in einer Warteschlange vordrängelt, verstößt nicht nur gegen ein unausgesprochenes Alltagsritual, sondern wird auch von anderen zur Rechenschaft gezogen („Was machen Sie da?“). Umgekehrt müssen Handlungen wie das „Drängeln“ durch Kontext oder Erklärung legitimiert werden (z.B. „Ich habe einen Notfall“).
Beispiele für Indexikalität, Reflexivität und Accountability
| Konzept | Beispiel | Erklärung |
|---|---|---|
| Indexikalität | „Das war ja klar!“ | Je nach Tonfall und Situation kann die Aussage Zustimmung, Ironie oder Vorwurf bedeuten – ihre Bedeutung ergibt sich erst aus dem Kontext. |
| Reflexivität | Berufskleidung im Krankenhaus | Das Tragen eines weißen Kittels signalisiert nicht nur berufliche Zugehörigkeit, sondern stellt die Ordnung „Arzt-Patient-Verhältnis“ her und legitimiert professionelles Handeln. |
| Accountability | Ein verspäteter Studierender entschuldigt sich mit „Die Bahn hatte Verspätung“ | Die Erklärung soll das Verhalten verständlich und sozial akzeptabel machen – sie dient der Herstellung von Normalität. |
Diese Konzepte machen deutlich, dass soziale NormenVerhaltensregeln und Erwartungen, die innerhalb einer Gesellschaft oder sozialen Gruppe als verbindlich gelten. und Regeln nicht nur befolgt, sondern auch ständig „in Szene gesetzt“ und in alltäglicher Praxis erzeugt werden.
Krisenexperimente (Breach-Experimente)
Einen besonders einprägsamen Beitrag zur Soziologie lieferte Garfinkel mit seinen sogenannten Krisenexperimenten oder Breach-Experiments. Dabei handelt es sich um gezielte Verletzungen alltäglicher Interaktionsregeln, mit dem Ziel, die selbstverständlichen Grundlagen sozialer Ordnung sichtbar zu machen. Garfinkel ging davon aus, dass soziale Ordnung nicht einfach „da“ ist, sondern fortwährend hergestellt werden muss – durch geteilte Routinen, unausgesprochene Erwartungen und gegenseitige Rechenschaftspflichten.
Die Experimente funktionieren nach einem einfachen Prinzip: Indem man sich im Alltag minimal „falsch“ verhält, geraten die Interaktionspartner:innen aus dem Gleichgewicht. Die Reaktionen – Verwunderung, Irritation, Korrekturversuche oder offene Sanktionen – zeigen, wie stark soziale Erwartungen das Verhalten strukturieren. Sie werden erst sichtbar, wenn sie verletzt werden.
Beispiele für klassische Krisenexperimente
- Student:innen sollen sich beim Abendessen zu Hause so verhalten, als wären sie fremde Gäste (z. B. mit „Darf ich bitte das Brot haben?“ oder „Könnte ich Ihre Toilette benutzen?“).
- In einem Smalltalk antwortet eine Versuchsperson nicht erwartungsgemäß auf die Frage „Wie geht’s?“ – etwa mit „Was genau meinen Sie mit ‚gehen‘?“.
- Eine Person zählt auf einer Rolltreppe laut rückwärts oder stellt sich in Fahrstühlen mit dem Gesicht zur Wand.
Die Reaktionen auf solche Regelverletzungen reichten von Irritation über Lachen bis hin zu echter Verärgerung – ein Indiz dafür, wie sehr soziale Erwartungen internalisiert sind. Garfinkels Fazit: Soziale Ordnung ist fragil, sie wird in jedem Moment durch das korrekte Befolgen informeller Regeln reproduziert – und kann ebenso schnell infrage stehen, wenn diese Regeln verletzt werden.
Wissenschaftliche Bedeutung
Die Krisenexperimente dienten nicht der Provokation um ihrer selbst willen, sondern waren eine methodische Strategie der Ethnomethodologie. Sie offenbaren die „background expectancies“ – die Hintergrundannahmen, auf denen Interaktionen beruhen – und machen das „doing social order“ erfahrbar. Zugleich zeigen sie, dass diese Ordnung keine übergeordnete Struktur ist, sondern das Resultat alltäglicher praktischer Rationalität.
Der Ansatz inspirierte viele spätere Forschungsrichtungen – von der Konversationsanalyse über die Mikrosoziologie bis hin zu experimentellen Ethnografien und performativen Interventionsstudien.
Beispiele für Breach-Experimente (Krisenexperimente)
| Experiment | Regelbruch | Reaktion |
|---|---|---|
| Gästeverhalten in der Familie | Distanzierte Sprache & höfliche Anrede gegenüber Eltern | Verwirrung, Sorge, Lachen, Ermahnung |
| Antwort auf „Wie geht’s?“ | Philosophische Gegenfrage: „Was meinen Sie genau mit ‚gehen‘?“ | Ratlosigkeit, Irritation, Abbruch des Gesprächs |
| Verhalten im Fahrstuhl | Zur Wand stehen statt zur Tür, keine „Fahrstuhl-Etikette“ | Blicke, Distanzvergrößerung, Lachen oder Verstummen |
Relevanz für die Soziologie
Garfinkels Werk steht in der Tradition der Phänomenologie (u.a. Alfred Schütz), grenzt sich jedoch durch seinen radikal empirischen Zugang ab. Er gilt als Pionier der qualitativen Sozialforschung und hat insbesondere die Gesprächsanalyse und die Untersuchung von Institutionen (z.B. Gerichtsverhandlungen, medizinische Konsultationen, Polizeiinteraktionen) entscheidend geprägt.
Verbindungen zu anderen Schlüsselwerken
- Goffman: Beide Autoren analysieren Mikrosituationen – Goffman mit dramaturgischer Metaphorik, Garfinkel mit konversationsanalytischer Schärfe.
- Cicourel: In The Social Organization of Juvenile Justice wendet Cicourel ethnomethodologische Prinzipien an, um institutionelle Selektionen aufzuzeigen.
- Labeling Approach: Auch die Etikettierungstheorie geht davon aus, dass DevianzVerhalten, das in einer Gesellschaft als unangemessen, abweichend oder regelverletzend gilt – unabhängig davon, ob es strafrechtlich relevant ist. nicht objektiv ist, sondern im sozialen Prozess entsteht.
Kritik und Diskussion
Garfinkel wurde mitunter für seine schwer zugängliche Sprache und methodische Strenge kritisiert. Auch der enge Fokus auf Mikrointeraktionen ließ strukturelle Ungleichheiten (z.B. Klasse, Geschlecht, RassismusRassismus bezeichnet die Diskriminierung, Abwertung oder Benachteiligung von Menschen aufgrund zugeschriebener „rassischer“ oder ethnischer Merkmale.) weitgehend unberücksichtigt. Dennoch gilt seine Ethnomethodologie als grundlegender Beitrag zur Soziologie, der auch für heutige Forschung (z.B. in Justiz, Medizin, Digitalisierung) relevante Impulse liefert.
Literatur
- Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Heritage, J. (1984). Garfinkel and Ethnomethodology. Cambridge: Polity Press.
- Maynard, D. W. (1989). Perspective-Display Sequences in Conversation. Western Journal of Speech Communication, 53(2), 91–113.


