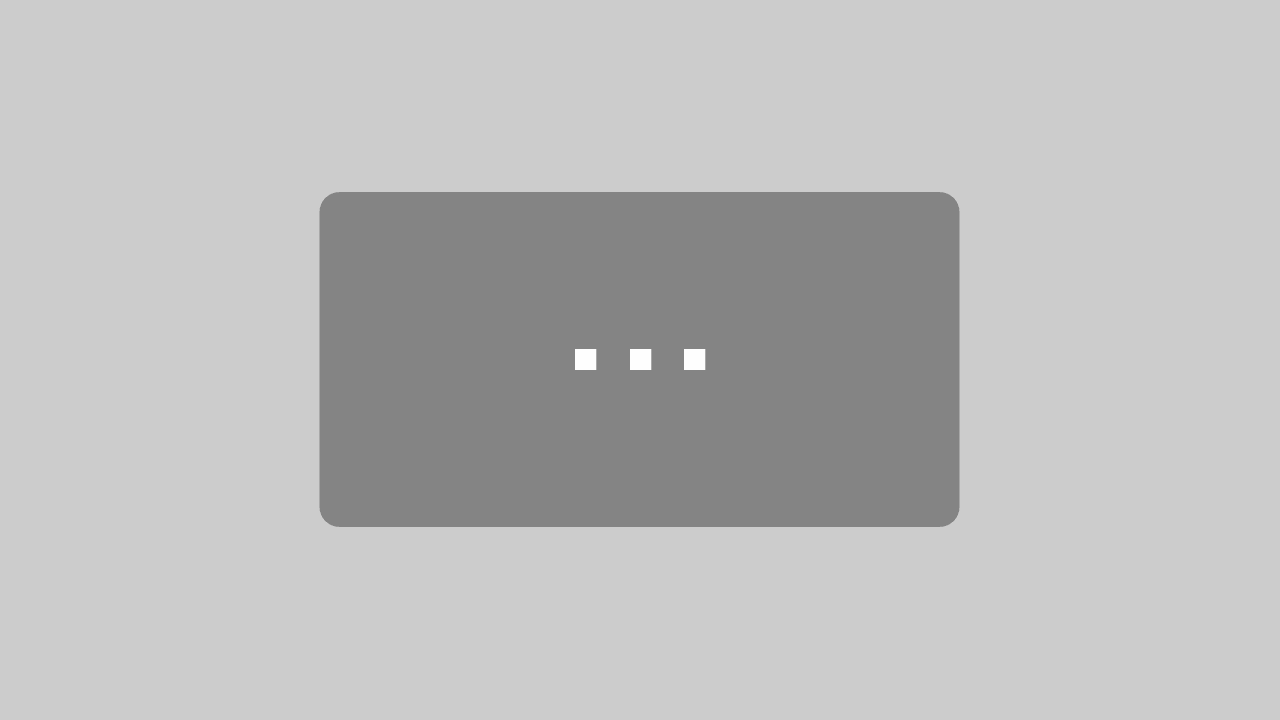Mit seinem Werk Bestrafen der Armen liefert der französisch-amerikanische Soziologe Loïc Wacquant eine scharfsinnige Analyse des Zusammenhangs von Armut, Strafjustiz und neoliberalem Staat. Die zentrale These: In Zeiten neoliberaler Umverteilung und sozialer Unsicherheit tritt der Strafapparat an die Stelle des Wohlfahrtsstaates – nicht um soziale Probleme zu lösen, sondern um die gesellschaftlichen Folgen wachsender Ungleichheit zu verwalten. Das Werk gilt heute als Schlüsseltext der kritischen Soziologie und wird weltweit in sozial- und kriminologisch geprägten Debatten rezipiert.
Autor und Entstehungskontext
Loïc Wacquant (*1960) ist Schüler und langjähriger Mitarbeiter von Pierre Bourdieu. Er lehrt an der University of California, Berkeley, und am Centre de sociologie européenne in Paris. Bestrafen der Armen erschien 2009 auf Englisch und basiert auf über 15 Jahren empirischer Forschung in US-amerikanischen Gefängnissen, Ghettos und politischen Institutionen. Der Text versteht sich als Fortsetzung und Erweiterung der Bourdieuschen Gesellschaftsanalyse – insbesondere in Hinblick auf den Staat, das Strafsystem und das soziale Feld der Armut.
*Bestrafen der Armen* beruht auf einer Kombination qualitativer und quantitativer Methoden:
- Ethnografische Feldforschung: Mehrjährige teilnehmende Beobachtung im afroamerikanischen Ghetto von Chicago, u. a. als Mitglied eines Boxclubs (Body & Soul, 2004).
- Sozialstatistische Analyse: Auswertung von Inhaftierungsraten, Sozialausgaben und politischen Reformen in den USA seit den 1980er-Jahren.
- Dokumenten- & Diskursanalyse: Untersuchung sicherheitspolitischer Leitbilder (z. B. „Zero Tolerance“) und neoliberaler Gesetzgebung (z. B. Workfare-Reformen).
Die Daten werden im Sinne Bourdieus theoriegeleitet interpretiert – mit dem Ziel, die symbolischen und strukturellen Mechanismen sozialer Kontrolle offenzulegen.
Bestrafen der Armen nach Loïc Wacquant

Hauptvertreter: Loïc Wacquant (*1960)
Erstveröffentlichung: 2009 (englisch), 2011 (deutsch)
Land: Frankreich / USA
Idee / Annahme: In neoliberalen Gesellschaften ersetzt der Strafstaat zunehmend den Sozialstaat. Polizei, Gefängnis und Kontrollapparate dienen der Verwaltung sozialer Unsicherheit.
Grundlage für: Kritische Staatssoziologie, Armuts- und Ungleichheitsforschung, Gefängnissoziologie, Polizei- und Prävention von Sicherheitsrisiken im öffentlichen und privaten Raum beschäftigt.">Sicherheitsforschung, Sozialpolitikforschung, kritische Kriminologie.
Zentrale Thesen
- Neoliberalismus als Doppelstrategie: Wacquant zeigt, dass neoliberale Staaten einerseits soziale Sicherungssysteme abbauen, andererseits den Strafapparat massiv ausbauen. Diese „rechte Hand des Staates“ (Polizei, Gefängnis, Kontrolle) kompensiert den Rückzug der „linken Hand“ (Sozialstaat).
- Das Gefängnis als soziales Instrument: In den USA (und zunehmend auch in Europa) wird das Gefängnis zur „sozialen Müllhalde“ – es absorbiert die von Arbeitslosigkeit, Prekarität und Wohnungsnot betroffenen Klassen.
- Stigmatisierung statt Integration: Arme und marginalisierte Bevölkerungsgruppen werden nicht mehr integriert, sondern diszipliniert, kontrolliert und symbolisch aus dem sozialen Körper ausgeschlossen.
- Der zentaurische Staat: Wacquant beschreibt die neue Staatsform als „Zentaur“ – oben liberal (Marktfreiheit), unten autoritär (Repression gegen die Schwachen).
 Der Begriff „zentaurischer Staat“ beschreibt eine Staatsform, die zwei gegensätzliche Prinzipien vereint: Oben – gegenüber den Wohlhabenden und Unternehmen – tritt der Staat liberal und zurückhaltend auf (Marktfreiheit, Deregulierung). Unten – gegenüber den sozial Marginalisierten – agiert er autoritär und kontrollierend (Polizei, Gefängnis, Überwachung). Wacquant verwendet das Bild des Zentauren (halb Mensch, halb Tier), um diese widersprüchliche Logik neoliberaler Staatlichkeit zu veranschaulichen: wirtschaftsliberal, aber repressiv – freundlich zum Kapital, hart gegenüber der Armut.
Der Begriff „zentaurischer Staat“ beschreibt eine Staatsform, die zwei gegensätzliche Prinzipien vereint: Oben – gegenüber den Wohlhabenden und Unternehmen – tritt der Staat liberal und zurückhaltend auf (Marktfreiheit, Deregulierung). Unten – gegenüber den sozial Marginalisierten – agiert er autoritär und kontrollierend (Polizei, Gefängnis, Überwachung). Wacquant verwendet das Bild des Zentauren (halb Mensch, halb Tier), um diese widersprüchliche Logik neoliberaler Staatlichkeit zu veranschaulichen: wirtschaftsliberal, aber repressiv – freundlich zum Kapital, hart gegenüber der Armut.Theoretische Einordnung
Wacquant verbindet makrosoziologische Staats- und Ungleichheitstheorie mit empirischer Feldforschung – ein Alleinstellungsmerkmal seines Ansatzes. Er greift dabei auf Konzepte von Pierre Bourdieu zurück, etwa:
- Habitus und symbolische Gewalt – um zu zeigen, wie soziale Hierarchien durch Institutionen wie Polizei oder Gerichte stabilisiert werden.
- Staatsanalyse – Wacquant denkt den Staat nicht als neutrale Instanz, sondern als umkämpftes Feld, das Klassenverhältnisse reproduziert.
Er steht damit in der Tradition von Autoren wie Michel Foucault oder Pierre Bourdieu, denen es ebenfalls darum geht, Machtverhältnisse im Alltag zu analysieren – insbesondere dort, wo sie sich hinter scheinbar neutralen Institutionen verbergen.
Beispielhafte Anwendung: USA und darüber hinaus
Wacquant analysiert insbesondere die USA als paradigmatischen Fall: Seit den 1980er-Jahren hat sich dort die Inhaftierungsrate vervielfacht – nicht trotz, sondern wegen neoliberaler Politik. Parallel dazu wurden Sozialleistungen gekürzt, Wohnprojekte abgebaut und der Zugang zu Bildung erschwert. Ähnliche Entwicklungen – wenn auch weniger extrem – sieht Wacquant in Europa, etwa bei der Ausweitung der Polizeibefugnisse, der Kriminalisierung von Armut oder repressiver Migrationspolitik.
Neoliberalismus bezeichnet eine politische und ökonomische Leitidee, die auf Marktfreiheit, Deregulierung, Privatisierung und die Reduktion staatlicher Sozialleistungen setzt. In der Soziologie wird Neoliberalismus nicht nur als Wirtschaftsdoktrin verstanden, sondern als gesellschaftlicher Umbau: Der Mensch wird zum „unternehmerischen Selbst“, soziale Risiken werden individualisiert, öffentliche Daseinsvorsorge wird zurückgefahren. Wacquant kritisiert besonders die doppelte Logik des Neoliberalismus: Sozialstaatlicher Rückzug für die Schwachen – autoritärer Ausbau für die Armen.
Warum Wacquants Werk auch für den deutschsprachigen Raum relevant ist
Auf den ersten Blick scheint Bestrafen der Armen ein Buch über US-amerikanische Verhältnisse zu sein: Masseninhaftierung, Ghettos, Sozialhilfereformen und „Zero Tolerance“-Politik stehen im Zentrum. Doch wer genauer hinschaut, erkennt schnell: Wacquants Analyse zielt nicht auf einen Sonderfall, sondern beschreibt einen globalen Strukturwandel im Verhältnis von Staat, Armut und Kontrolle – einen Wandel, der auch in Europa und Deutschland deutlich spürbar ist.
Gesellschaftstheorie statt Länderstudie
Wacquant versteht den Strafstaat als Bestandteil einer umfassenden neoliberalen Transformation, die das gesamte Gefüge sozialer Sicherung, staatlicher Legitimität und öffentlicher Ordnung neu strukturiert. In diesem Sinne ist sein Werk kein soziologischer Reisebericht über die USA, sondern ein theoriegeleiteter Beitrag zur kritischen Staats- und Ungleichheitsforschung, dessen Kernaussagen auch auf Deutschland übertragbar sind.
Parallelen zur deutschen Entwicklung
- Auch in Deutschland ist seit den 1990er-Jahren ein Rückbau sozialstaatlicher Leistungen (z. B. im Zuge von Hartz IV) mit einem Ausbau von Kontrollmechanismen (z. B. Ausländerbehörden, Polizei, Sicherheitspolitik) verknüpft.
- Städte entwickeln zunehmend Strategien der Raumkontrolle, etwa durch Videoüberwachung, Waffenverbotszonen oder Platzverweise – oft in sozial benachteiligten Vierteln.
- Diskurse über „Clankriminalität“, „Armutszuwanderung“ oder „Integrationsverweigerer“ verknüpfen soziale Unsicherheit mit repressiven Lösungsstrategien.
- Auch im deutschen Kontext zeigt sich: Armut wird zunehmend verwaltet, überwacht und sanktioniert – nicht integriert.
Beitrag zur Ausbildung und Forschung
Für Studierende und Forschende bietet Wacquants Werk theoretische Tiefe und empirische Inspiration gleichermaßen: Seine Verbindung aus Feldforschung, Statistik und Staatskritik eröffnet neue Perspektiven auf soziale Kontrolle, Ungleichheit und politische Repräsentation. Gerade in der Sozialpolitik, Kriminologie, Migrations- und Polizeiforschung liefert Wacquant Werkzeuge, um strukturelle Fragen jenseits individueller Schuldzuweisungen zu stellen.
Wacquants Analyse der „Regierung sozialer Unsicherheit“ zielt nicht nur auf die USA, sondern beschreibt einen übergreifenden Trend westlicher Gesellschaften: Sozialstaatliche Sicherung wird zurückgefahren, während Repression und Kontrolle ausgebaut werden. Auch in Europa – etwa in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien – zeigen sich Parallelen:
- zunehmende Kriminalisierung von Armut und Migration
- Ausweitung polizeilicher Befugnisse und Überwachung
- Diskurse über „Sicherheitszonen“, „Integrationsverweigerung“ und „Problemquartiere“
Wacquants Begriff der Punitivität hilft, diese Entwicklungen nicht als bloße Sicherheitspolitik, sondern als gesellschaftliche Strategie zur Steuerung von Ungleichheit zu verstehen.
Fazit
Bestrafen der Armen liefert keine Blaupause für Deutschland – aber einen analytischen Spiegel. Wacquant hilft zu erkennen, wie sich neoliberale Regime nicht nur über Märkte, sondern auch über Körper, Räume und Institutionen stabilisieren. Sein Werk ist damit auch im deutschsprachigen Raum ein unverzichtbarer Beitrag zur soziologischen Selbstverständigung über Staatlichkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische Kontrolle.
Fazit
Bestrafen der Armen ist ein soziologisches Schlüsselwerk, das mit empirischer Schärfe und theoretischer Tiefe aufzeigt, wie moderne Gesellschaften mit ihren eigenen Schattenseiten umgehen. Wacquants zentrale Botschaft: Repression ist kein Ausrutscher – sie ist struktureller Bestandteil eines Staates, der sich vom Versprechen sozialer Absicherung verabschiedet hat. Wer den Zusammenhang von Armut, Strafpolitik und sozialer Kontrolle verstehen will, kommt an diesem Werk nicht vorbei.
Literatur und weiterführende Informationen
- Wacquant, Loïc (2009): Bestrafen der Armen. Zur neoliberalen Regierung der sozialen Unsicherheit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Wacquant, Loïc (2009): Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity. Durham: Duke University Press.
- Bourdieu, Pierre (1998): Die männliche Herrschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Homepage von Loïc Wacquant: https://loicwacquant.org/
YouTube-Video: Bringing the Penal State Back In