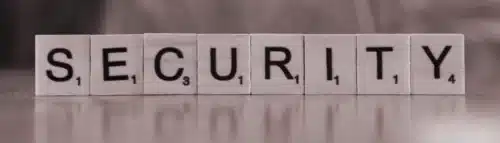Kurzüberblick: Dieser Beitrag analysiert die Umsetzung des Konsumcannabisgesetzes (KCanG) seit April 2024. Themen sind u. a. die Ziele der Reform, rechtliche Änderungen, föderale Unterschiede, polizeiliche Kontrollpraxis, Ergebnisse des EKOCAN-Zwischenberichts, Versorgung durch Anbauvereinigungen und Medizinalcannabis sowie die Blockade der zweiten Säule mit lizenzierten Fachgeschäften. Der Text zeigt, wo Entkriminalisierung wirkt –
Prävention
Lucia Zedner – Security (2009)
Sicherheit als umkämpftes Konzept Mit ihrem Werk Security (2009) legt die britische Rechtswissenschaftlerin und Kriminologin Lucia Zedner eine normativ sensible, interdisziplinär fundierte und präzise Analyse des Sicherheitsbegriffs vor. Sie zeigt, dass „Sicherheit“ kein objektiv beschreibbares Gut ist, sondern eine vielschichtige soziale Konstruktion, die in Politik, Strafrecht und Gesellschaft unterschiedlich funktionalisiert
Markus D. Dubber – The Police Power (2005)
The Police Power: Patriarchy and the Foundations of American Government (2005) ist ein grundlegendes Werk des deutsch-amerikanischen Rechtswissenschaftlers Markus D. Dubber. In der Tradition kritischer Rechtsphilosophie legt Dubber die genealogischen und ideologischen Grundlagen des staatlichen Gewaltmonopols offen – insbesondere der Exekutivgewalt, die nicht durch Strafrecht, sondern durch soziale Kontrolle wirkt.
Two-Path-Theory (Moffitt)
Die Two-Path-Theory beruht u.a. auf einer Langzeitstudie zur Kriminalitätsbelastung von 1.000 neuseeländischen Jugendlichen („Die tausend Kinder von Dunedin“ oder „Dunedin-Studie“). In dieser Untersuchung wurden zwei wesentliche Entwicklungsverläufe gefunden: Die erste und zahlenmäßig größere Gruppe der Jugendlichen zeigte ein für das Jugendalter übliche Maß an Verhaltensauffälligkeiten. Das deviante Verhalten der Probanden
Betäubungsmittelkriminalität
Betäubungsmittelkriminalität umfasst alle strafrechtlich relevanten Handlungen im Zusammenhang mit Substanzen, die im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) geregelt sind. Dazu zählen Herstellung, Besitz, Handel, Einfuhr und weitere Delikte. Der Konsum an sich ist nicht strafbar, allerdings ist dieser in den meisten Fällen mit Besitz verbunden, welcher wiederum strafrechtlich verfolgt wird. In Deutschland gelten
Raum und (Un-)Sicherheit
Raum und (Un-)Sicherheit stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Schon in den 1920er-Jahren zeigten Wissenschaftler der Chicago School, dass Kriminalität räumlich ungleich verteilt ist – unabhängig von den Bewohnern. Räume können somit selbst zu Risikofaktoren werden. Die Theorie der „sozialen Desorganisation“ geht davon aus, dass Räume Kriminalität hervorbringen und diese weitgehend