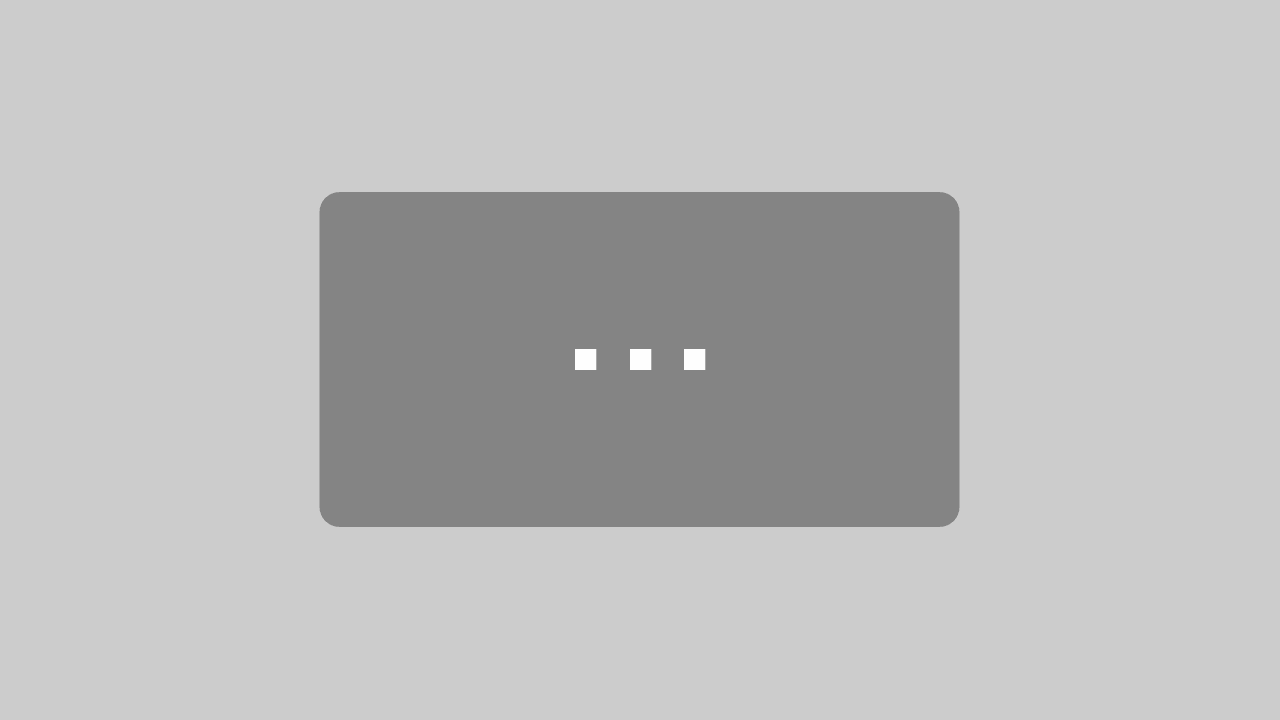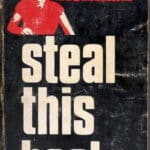Mit Tearing Down the Streets veröffentlichte der US-amerikanische Soziologe und Kriminologe Jeff Ferrell im Jahr 2001 ein Werk, das exemplarisch für die Cultural Criminology steht. Ferrell untersucht darin, wie sich urbane Räume durch Praktiken wie Graffiti, Skateboarding oder Punk-Musik in Konfliktzonen verwandeln, in denen sich staatliche Ordnung, wirtschaftliche Interessen und subkultureller Widerstand begegnen. Das Buch ist zugleich Analyse und autobiografischer Erfahrungsbericht: Als teilnehmender Beobachter dokumentiert Ferrell seine eigenen Erfahrungen auf der Straße – ein Ansatz, der für seine gesamte Forschung charakteristisch ist.
Ferrell ist bekannt dafür, außergewöhnliche ethnografische Forschungsprojekte zu verfolgen. Seine Arbeiten kreisen um gesellschaftlich marginalisierte, aber kulturell ausdrucksstarke Praktiken – etwa Graffiti-Sprayer, Dumpster Diver, „urban drifters“ oder subkulturelle Communities. Durch seine Nähe zum Untersuchungsgegenstand gelingt es ihm, tief in die Lebenswelt devianter Akteure einzutauchen – ohne diese zu romantisieren oder zu kriminalisieren.
Merkzettel
Tearing Down the Streets – Jeff Ferrell
Hauptvertreter: Jeff Ferrell
Erstveröffentlichung: 2001
Land: USA
Idee/Annahme: Urbane DevianzVerhalten, das in einer Gesellschaft als unangemessen, abweichend oder regelverletzend gilt – unabhängig davon, ob es strafrechtlich relevant ist. ist ein kultureller Ausdruck sozialen Widerstands gegen neoliberale Ordnungspolitiken. Der urbane Raum ist Schauplatz von Macht und Gegenmacht.
Verwandte Theorien: Cultural Criminology, Urban Criminology, Zero Tolerance, Raumsoziologie
Urbaner Raum als Austragungsort sozialer Kämpfe
Im Zentrum von Tearing Down the Streets steht die Beobachtung, dass Städte nicht nur architektonisch, sondern auch normativ konstruiert sind. Die urbane Ordnung wird durch Polizeikontrollen, Überwachung, Medienkampagnen und städtebauliche Aufwertungsmaßnahmen (z. B. GentrifizierungGentrifizierung bezeichnet den sozioökonomischen Wandel städtischer Viertel, bei dem einkommensschwache Bevölkerungsgruppen durch wohlhabendere verdrängt werden. Der Prozess geht oft mit einer Aufwertung der Wohn- und Lebensqualität, aber auch mit steigenden Mieten und sozialer Verdrängung einher.) hergestellt – oft unter dem Vorzeichen von Zero Tolerance oder Broken Windows. Diese Politik der „Sauberen Stadt“ verdrängt nicht nur Armut und SubkulturEine Subkultur bezeichnet eine Gruppe innerhalb einer Gesellschaft, die sich durch abweichende Werte, Normen, Verhaltensweisen oder symbolische Ausdrucksformen von der Mehrheitskultur unterscheidet., sondern kriminalisiert zugleich alltägliche Praktiken, die nicht in das Bild der neoliberalen Stadt passen.
Ferrell zeigt, dass diese Praktiken keineswegs sinnlos oder destruktiv sind: Vielmehr stellen sie subversive Aneignungen dar, durch die sich marginalisierte Gruppen Raum und Sichtbarkeit zurückerobern. In dieser Perspektive wird Graffiti zu einer Form des visuellen Protests, Skateboarding zu einer Umdeutung urbaner Funktionalität und Punk-Musik zu einem akustischen Widerstand gegen die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums.
Theoretischer Rahmen
Ferrells Analyse steht in der Tradition einer kritisch-kulturtheoretischen Soziologie. Zentral ist dabei die Annahme, dass kulturelle Ausdrucksformen – wie Graffiti oder Musik – nicht nur symbolischen Wert haben, sondern tief in soziale Konflikte eingebettet sind. In Anlehnung an Pierre Bourdieu analysiert Ferrell die urbane Ordnung als Form symbolischer Gewalt, die durch Raumkontrolle, Klassenausschluss und mediale KriminalisierungDer Prozess, durch den bestimmte Handlungen oder Verhaltensweisen durch gesetzliche Bestimmungen als kriminell definiert und strafrechtlich verfolgt werden. stabilisiert wird.
Zugleich greift er auf Konzepte von Michel de Certeau zurück, etwa dessen Idee der „Taktiken“ – also alltägliche Praktiken, mit denen sich Menschen kreativ über vorgegebene Strukturen hinwegsetzen. Der Raum wird hier nicht nur als physisches Gebilde, sondern als soziales Machtfeld verstanden. Der urbane Widerstand artikuliert sich demnach im Alltäglichen – sichtbar, laut, widerspenstig.
Methodologie: Teilnehmende Beobachtung als Erkenntnisweg
Tearing Down the Streets ist nicht nur ein theoretisches Werk, sondern auch ein autoethnografisches Tagebuch. Ferrell berichtet von eigenen Erlebnissen als Graffiti-Sprayer, Straßenmusiker oder Teilnehmer an Protestaktionen. Seine Forschungsmethodik ist geprägt von Nähe und Subjektivität – in bewusster Abgrenzung zur vermeintlich „neutralen“ Beobachterposition klassischer Sozialforschung.
Diese Herangehensweise macht das Werk besonders eindrücklich, wirft aber auch Fragen auf: Inwiefern ist Ferrells Perspektive repräsentativ? Wo verlaufen die Grenzen zwischen Analyse und Apologie? In der Cultural CriminologyCultural Criminology ist ein kriminologischer Ansatz, der Kriminalität und soziale Kontrolle als kulturell geprägte Phänomene versteht und analysiert. Im Fokus stehen die Bedeutungen, Symbole und gesellschaftlichen Diskurse, die Kriminalität umgeben. wird diese Subjektivität nicht als Makel, sondern als epistemische Stärke verstanden: Erkenntnis entsteht durch Teilhabe.
Relevanz für die Kriminologie
Tearing Down the Streets ist ein Schlüsseltext der Cultural Criminology. Ferrell gelingt es, KriminalitätKriminalität bezeichnet gesellschaftlich normierte Handlungen, die gegen das Strafgesetz verstoßen. als kulturelle Praxis sichtbar zu machen – jenseits juristischer Kategorien. Das Buch liefert wichtige Impulse für:
- die Analyse urbaner Kriminalisierung (z. B. von Obdachlosen, Jugendlichen, Sprayern)
- die Kritik an raumbezogener Polizeiarbeit (z. B. Zero Tolerance, Hot-Spot-Policing)
- die Erforschung von Widerstandsformen im öffentlichen Raum
- die Debatte um legitime Aneignung urbaner Ressourcen
Auch im Kontext von Segregation, Exklusion und Urban Criminology gewinnt Ferrells Ansatz an Bedeutung: Die Stadt wird zum Spiegel gesellschaftlicher Machtverhältnisse – und zum Ort ihrer möglichen Unterwanderung.
Kritik und Rezeption
Das Werk wurde vielfach rezipiert und in zahlreiche Lehrpläne aufgenommen. Gelobt wird vor allem die Verbindung von Theorie und Erfahrung, die anschauliche Sprache und der kritische Blick auf Sicherheits- und Ordnungspolitiken. Kritisch angemerkt wird mitunter die Subjektzentriertheit der Darstellung, die eine Verallgemeinerung der Ergebnisse erschwert.
Trotzdem (oder gerade deshalb) gilt Ferrells Buch heute als prägender Beitrag zur kritischen Kriminologie und als Vorläufer aktueller Studien zur Kriminalisierung urbaner ArmutArmut beschreibt den Mangel an materiellen, sozialen und kulturellen Ressourcen, die notwendig sind, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben., polizeilicher Repression und urban resistance.
Fazit
Tearing Down the Streets ist mehr als ein Forschungsbericht – es ist ein eindrucksvolles Zeugnis teilnehmender Kriminologie. Ferrell zeigt, dass urbane Devianz nicht bloß Regelverstoß ist, sondern kultureller Ausdruck, politische Artikulation und sozialer Protest. Wer das Verhältnis von Stadt, MachtMacht bezeichnet die Fähigkeit von Personen oder Gruppen, das Verhalten anderer zu beeinflussen – auch gegen deren Willen. und Kriminalität verstehen will, findet in diesem Werk eine radikale, aber erkenntnisreiche Perspektive.
Übertragbarkeit kulturkriminologischer Konzepte von Jeff Ferrell in den deutschen Kontext
1. Kulturelle Spezifik US-amerikanischer Urbanität
Ferrells Analysen – insbesondere in Tearing Down the Streets – sind tief in der städtischen Realität US-amerikanischer Metropolen verankert. Die dort sichtbaren Regelwerke wie „No Trespassing“-, „No Loitering“- oder „Anti-Graffiti“-Zonen sind Ausdruck einer strikt regulierten Nutzung des öffentlichen Raums. Sie spiegeln ein gesellschaftliches Klima wider, das stark auf Eigentumsschutz, Kontrolle und Ausschluss basiert – begünstigt durch den juristischen Rückgriff auf private property, stand-your-ground laws und eine kommodifizierte Urbanität.
In deutschen Städten gibt es vergleichbare Tendenzen – etwa durch Videoüberwachung, Platzverweise, Hausordnungen in Bahnhöfen, Antigraffiti-Politiken oder „Ordnungsämter auf Streife“ –, allerdings sind sie meist weniger systematisch und juristisch verankert. Die in den USA gängige Kombination aus „broken windows policing“, privater Sicherheitsindustrie und municipal ordinances zur Verhaltensregulation ist in dieser Form (noch) nicht flächendeckend institutionalisiert.
2. Übertragbarkeit in kriminologischer Hinsicht
Trotz der kulturellen Unterschiede bietet Ferrells Werk eine Reihe von Anknüpfungspunkten für die deutsche Kriminologie und StadtsoziologieStadtsoziologie ist ein Teilgebiet der Soziologie, das sich mit der sozialen Struktur, den Lebensbedingungen, Konflikten und Entwicklungsprozessen urbaner Räume beschäftigt. Sie analysiert, wie Städte als soziale Räume organisiert sind, welche sozialen Interaktionen dort stattfinden und wie urbane Lebensweisen die Gesellschaft beeinflussen.:
- Kriminalisierung marginalisierter Gruppen – etwa Obdachlose, Sprayer oder Jugendliche mit Migrationshintergrund
- Symbolische Ordnungsproduktion – durch PolizeiDie Polizei ist eine staatliche Institution zur Gefahrenabwehr, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Verfolgung von Straftaten., Medien, Stadtplanung und kommunale Regulation
- Subkulturelle Aneignung des Raums – z. B. durch Graffiti, Street Art, Musik oder urbane Protestformen
- Debatten um Sicherheit und Sichtbarkeit – besonders im Kontext von „Angsträumen“, „Problemvierteln“ oder Gentrifizierung
In vielen deutschen Großstädten lässt sich eine wachsende Tendenz zur sicherheitsorientierten Stadtpolitik beobachten – etwa durch den Ausbau kommunaler Ordnungspartnerschaften, Alkoholverbote im öffentlichen Raum, Einschränkungen von Versammlungen oder die städtebauliche Kriminalprävention. In diesen Bereichen lassen sich Ferrells Analysen produktiv anwenden.
3. Methodologischer und theoretischer Gewinn
Unabhängig vom kulturellen Setting ist Ferrells Ansatz methodisch und theoretisch hoch relevant. Seine ethnografische Tiefenschärfe, die Reflexion von Macht, Raum und Kultur sowie die Sichtbarmachung von Devianz als Ausdruck und nicht bloß Regelbruch, haben auch im deutschsprachigen Raum Wirkung entfaltet – etwa in der Stadtforschung, Kritischen Kriminologie oder Cultural Criminology.
Auch deutsche Forscher:innen wie Rafael Behr, Daniel Loick, Talja Blokland oder Robert Chr. van Ooyen nehmen Bezug auf diese Perspektiven – oft mit eigenständiger empirischer Fundierung.
Fazit
Ferrells Werk ist nicht 1:1 übertragbar, aber hoch anschlussfähig. Wer den urbanen Raum als sozialen Kampfplatz um Sichtbarkeit, Legitimität und Kontrolle begreift, kann von seinem Werk enorm profitieren – gerade in Zeiten zunehmender Sicherheitslogiken, Polarisierung und Raumverdrängung auch in Deutschland.
Ein produktiver Umgang mit Ferrells Ansatz besteht darin, ihn als Analytik urbaner Machtverhältnisse zu verstehen – und dann lokal konkret zu prüfen, wie sich vergleichbare Dynamiken im deutschen Kontext zeigen: subtiler, bürokratischer, oft legalistisch verbrämt – aber keineswegs weniger wirkungsvoll.
Literatur und weiterführende Informationen
- Ferrell, Jeff (1993): Crimes of Style: Urban Graffiti and the Politics of Criminality. Boston: Northeastern University Press.
- Ferrell, Jeff (2001): Tearing Down the Streets: Adventures in Urban Anarchy. New York: Palgrave.
- Ferrell, Jeff (2006): Empire of Scrounge: Inside the Urban Underground of Dumpster Diving, Trash Picking, and Street Scavenging. New York: NYU Press.
- Ferrell, Jeff / Hayward, Keith / Young, Jock (2008): Cultural Criminology: An Invitation. London: SAGE.
- Snyder, Gregory J. (2009): Graffiti Lives: Beyond the Tag in New York’s Urban Underground. New York: NYU Press.
- de Certeau, Michel (1984): The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.
- Bourdieu, Pierre (1991): Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.
- Lefebvre, Henri (1996): Writings on Cities. Oxford: Blackwell.
Video
Ein Vortrag von Jeff Ferrell zu seiner Forschungsperspektive ist auf YouTube verfügbar.