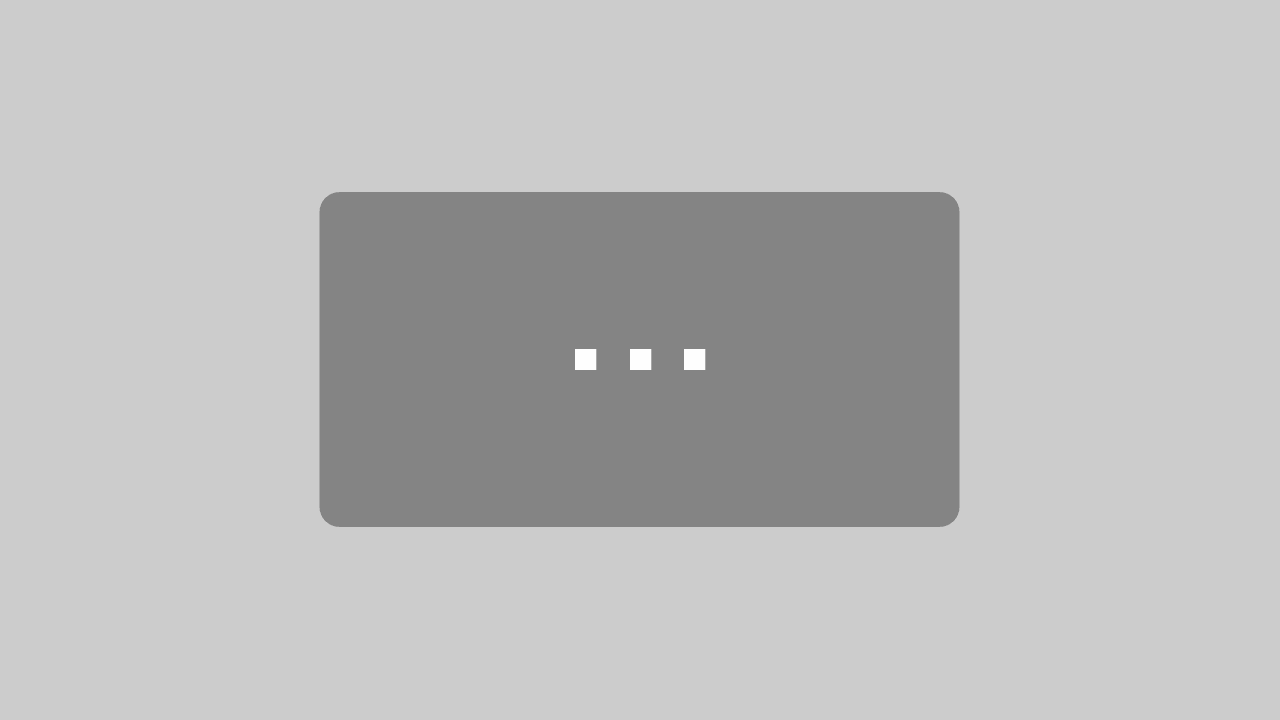Stephen Graham legt mit „Cities Under Siege: The New Military Urbanism“ (2010) ein ebenso verstörendes wie einflussreiches Werk vor, das die schleichende Militarisierung urbaner Räume analysiert. Vor dem Hintergrund des „War on Terror“ und einer globalisierten Sicherheitsarchitektur zeigt Graham, wie sich militärische Logiken, Technologien und Kontrollpraktiken zunehmend in das Alltagsleben westlicher Städte einschreiben. Das Buch ist damit ein Schlüsseltext der kritischen Prävention von Sicherheitsrisiken im öffentlichen und privaten Raum beschäftigt.">Sicherheitsforschung also jenes interdisziplinären Forschungszweigs, der Sicherheitspraktiken nicht normativ affirmiert, sondern in ihren politischen, ökonomischen und sozialen Effekten analysiert. Cities Under Siege findet auch in der Kriminologie wachsende Beachtung.
Grahams zentrale These lautet: Die Trennung zwischen Krieg und Polizei, zwischen äußerer Feinderkennung und innerer Ordnungssicherung, wird in der „neuen militärischen Urbanistik“ zunehmend aufgehoben. Städtische Räume verwandeln sich in Schlachtfelder präventiver Kontrolle – durch Überwachung, Zugriffstechnologien, Sicherheitszonen, Mauern, biometrische Erfassung und Risikobewertung. Kontrollpolitik wird zur Raumpolitik – differenziert nach Klasse, Herkunft, Mobilität und Sichtbarkeit.
Merkzettel
Cities Under Siege: The New Military Urbanism
Autor: Stephen Graham
Erstveröffentlichung: 2010
Land: Großbritannien
Zentrale Annahme: Militärische Logiken und Sicherheitsregime dringen zunehmend in zivile urbane Räume ein und verändern soziale Ordnung, Architektur und politische Steuerung nachhaltig.
Verwandte Theorien: Michel Foucault (Disziplin/Macht), Loïc Wacquant (Urban Marginality), Giorgio Agamben (Ausnahmezustand), Paul Virilio (Dromologie), Lucia Zedner (Sicherheitsdispositiv), Alessandro De Giorgi (Regieren durch Risiko), Cultural Criminology
Zentrale Thesen
Militarisierung des Urbanen: Graham zeigt, dass Städte zunehmend nicht mehr als zivile Lebensräume verstanden werden, sondern als potenzielle Krisenzonen und Sicherheitsrisiken. In westlichen Metropolen – ebenso wie in konfliktbelasteten Regionen – halten militärische Denkweisen und Technologien Einzug in den urbanen Alltag. Kontrollpraktiken wie Checkpoints, Sicherheitsschleusen, bewaffnete Patrouillen, Mauersysteme, Drohneneinsätze oder biometrische Scans, die ursprünglich für militärische Einsätze konzipiert wurden, werden auf urbane Kontexte übertragen. Diese Verschiebung beruht auf der Logik präemptiver Gefahrenabwehr und führt dazu, dass die Stadt als „potenzielles Schlachtfeld“ wahrgenommen wird – insbesondere in marginalisierten Vierteln oder gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen.
Raum als Sicherheitsarchitektur: Städte werden zunehmend nach sicherheitslogischen Kriterien gestaltet. Urbanes Design wird zum Mittel der Kontrolle: Videoüberwachung, „defensible space“-Konzepte, städtische Sicherheitszonen, Zugangsbeschränkungen und sogenannte „hostile architecture“ (z. B. Sitzbänke mit Armlehnen, um Obdachlose fernzuhalten) zielen auf die Regulierung von Verhalten im öffentlichen Raum. Graham analysiert, wie diese räumlichen Maßnahmen nicht nur Sicherheit versprechen, sondern gezielt soziale Exklusion erzeugen – etwa durch die Ausgrenzung unerwünschter Gruppen wie Jugendliche, Arme oder Migrant:innen. Die Stadt wird dadurch zur selektiven Zone: durchlässig für Wohlstand und Konsum, restriktiv gegenüber Abweichung und Abhängigkeit. Diese Prozesse lassen sich auch mit Begriffen der Stadtsoziologie erfassen, die den öffentlichen Raum als Spiegel gesellschaftlicher Machtverhältnisse begreift
Duale Mobilität: Während globale Eliten, Kapitalströme und Konsumgüter nahezu ungehindert zirkulieren, unterliegen andere Akteure einer zunehmenden Kontrolle, Selektion oder Immobilisierung. Graham spricht in diesem Zusammenhang von einer „Splintering Urbanism“ – einer fragmentierten Stadtstruktur, in der sich privilegierte Mobilität und restriktive Immobilität gegenüberstehen. Migrationskontrolle, städtische Vertreibungspolitik, rassifizierte Polizeipraktiken und digitale Überwachungsregime tragen dazu bei, dass Bewegungsfreiheit ungleich verteilt ist. Die Stadt als Transit- und Lebensraum wird damit zum Ort der sozialen Segmentierung entlang von Klasse, Ethnie und Aufenthaltsstatus.
Auflösung der Grenzen zwischen Krieg und Polizei: In der neuen Sicherheitsarchitektur verschwimmen die traditionellen Grenzen zwischen militärischer Kriegsführung und polizeilicher Gefahrenabwehr. Konzepte wie Counterinsurgency, Targeting oder Surveillance, die aus dem militärischen Kontext stammen, werden in den zivilen Raum übertragen. Graham argumentiert, dass sich Polizei, Militär, private Sicherheitsfirmen und technologische Dienstleister zu einem hybriden Sicherheitskomplex verbinden, der nicht nur auf konkrete Bedrohungen reagiert, sondern auf präemptive Kontrolle zielt. Risikobewertung, Data Mining und biometrische Klassifikationen ersetzen dabei zunehmend rechtsstaatliche Prinzipien der individuellen Unschuldsvermutung.
Städtische Kriegführung: Anhand zahlreicher Fallbeispiele – etwa aus Bagdad, Gaza, Johannesburg, London oder New York – zeigt Graham, wie sich urbane Räume unter Bedingungen des Ausnahmezustands verändern. Techniken der militärischen Besatzung (z. B. „zoning“, Mauern, „green zones“) werden adaptiert und zivil genutzt. Dabei geraten nicht nur Konfliktzonen, sondern auch westliche Städte in den Blick: etwa wenn bei Großereignissen wie G20-Gipfeln, Demonstrationen oder nach terroristischen Anschlägen umfassende Überwachungs- und Zugriffssysteme aktiviert werden. Der städtische Raum wird so zum Experimentierfeld autoritärer Steuerung – mit Folgen für Demokratie, Öffentlichkeit und städtische Teilhabe.
Rezeption und Bedeutung
„Cities Under Siege“ gilt als einflussreiches Werk der kritischen Urbanistik, der Sicherheitsforschung und der Raumsoziologie. Es hat zahlreiche Debatten über die Rolle von Architektur, Technologie und Governance in städtischen Sicherheitsdiskursen angestoßen. In der Kriminologie wurde es insbesondere im Kontext der Cultural Criminology, der Überwachungsforschung und der technokratischen Sicherheitssteuerung rezipiert. Grahams Perspektive verweist auf eine zentrale Schnittstelle zwischen Raumsoziologie, Polizei- und Kriminalitätsforschung.
Eine inhaltliche Erweiterung und Vertiefung der Debatten um urbane Kontrolle und neoliberale Raumpolitik findet sich in Raquel Rolniks Werk Urban Warfare: Housing under the Empire of Finance (2022). Die brasilianische Stadtsoziologin analysiert darin, wie der globale Finanzkapitalismus zunehmend den Wohnraum als Anlageobjekt kolonialisiert – mit weitreichenden Folgen für Verdrängung, Exklusion und urbane Ungleichheit. Ihre Perspektive ergänzt Grahams Fokus auf sicherheitspolitische Urbanistik um eine wirtschaftspolitische Dimension städtischer Transformation.
Reflexion und Kritik
Stephen Grahams Cities Under Siege beeindruckt durch seine umfangreiche empirische Fundierung und die plastische Darstellung städtischer Sicherheitsarchitekturen. Rezensent George Steinmetz (2012) bezeichnet das Buch dementsprechend als „fascinating and depressing overview of the ongoing militarization of urban space and the reorientation of the military toward urban warfare“ . Gleichzeitig wird bemängelt, dass sich die vielfachen Fallstudien mitunter negativ auf die analytische Präzision auswirken. Steinmetz schreibt, dass die „Anhaufung von Beispielen … zu Lasten der theoretischen Klarheit“ gehe – ein Hinweis, dass die Dichte an empirischen Fällen gelegentlich die konzeptionelle Stringenz belastet .
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den durchweg dystopischen Grundton des Werks. In der Rezension von Nicholas Lezard im Guardian (2011) heißt es, das Buch könne aus der „militärischen Logik städtischer Kontrolle ein atmosphärisches Alarmbild erzeugen“ – und zwar mit belastbarer Dokumentation, doch ohne Raum für emanzipative oder widerständige Perspektiven . Tatsächlich fehlt es Graham an einer systematischen Untersuchung solcher Gegenbewegungen, was manche Rezensent:innen als konzeptionelle Schwäche sehen.
Ungeachtet solcher Bedenken gilt Cities Under Siege als bedeutender Beitrag zur kritischen Stadtforschung. Besonders relevant bleibt das Buch angesichts aktueller technopolitischer Entwicklungen: mit Blick auf aktuelle Entwicklungen wie KI-gestützte Videoüberwachung bei der Olympiade 2024 in Paris, die Digitalisierung von Grenzregimen oder den Ausbau von Smart-City-Infrastrukturen. Zugleich zeigt sich, dass sein Ansatz weitergedacht werden muss: um eine differenzierte, emanzipatorische Analyse urbaner Kontrolle, die auch alternative, demokratische Raumnutzungsformen in den Blick nimmt.
Einordnung aus europäischer Perspektive
Während Stephen Grahams Analyse in angloamerikanischen und konfliktgeprägten Kontexten große Resonanz gefunden hat, fällt die Rezeption im deutschsprachigen Raum differenzierter aus. Aus europäischer Sicht erscheint das von Graham entworfene Szenario einer flächendeckenden „urbanen Belagerung“ streckenweise überzeichnet – insbesondere dort, wo Städte nahezu ausschließlich als Räume von Kontrolle, Repression und Kriegführung beschrieben werden.
Tatsächlich stützt sich Graham primär auf Fallstudien aus dem globalen Süden, aus autoritär regierten Staaten oder aus stark militarisierten Gesellschaften wie den USA, Großbritannien oder Israel. Diese Fallauswahl prägt die zugrunde liegende Argumentation maßgeblich: Prozesse wie die Auflösung der Grenze zwischen Polizei und Militär, die Internalisierung militärischer Techniken in urbanes Design oder der Aufbau umfassender Überwachungsregime erscheinen dort nachvollziehbar – lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres auf mitteleuropäische Städte übertragen.
In liberalen Demokratien wie Deutschland bestehen vergleichsweise starke rechtliche und institutionelle Schranken gegen sicherheitspolitische Übergriffigkeit. Datenschutzgrundsätze, föderale Polizeistrukturen, parlamentarische Kontrolle sowie eine historisch gewachsene Sensibilität gegenüber autoritärer Überwachungskultur wirken als wichtige Gegenpole. Auch wenn etwa Videoüberwachung, Predictive Policing oder Anti-Terror-Gesetze zunehmend in den urbanen Alltag einsickern, ist deren Ausmaß bislang kaum mit den im Buch skizzierten Ausnahmezuständen vergleichbar.
Darüber hinaus bleibt in Grahams Darstellung der städtische Raum fast ausschließlich ein Feld hegemonialer Machtausübung. Formen zivilgesellschaftlichen Widerstands, städtischer Gegenöffentlichkeiten oder aktivistischer Aneignung – wie sie etwa in Bewegungen wie Recht auf Stadt, Ende Gelände, Park Fiction oder Seebrücke sichtbar werden – spielen kaum eine Rolle. Gerade europäische Städte zeichnen sich jedoch durch eine lebendige Kultur des urbanen Protests und der demokratischen Aushandlung von Raum aus.
Schließlich ist auch Grahams Sprache selbst ein Gegenstand kritischer Betrachtung. Begriffe wie „urban siege“, „militarization of everyday life“ oder „city as battlespace“ erzeugen eine Dramaturgie, die in akademischen Diskursen des deutschsprachigen Raums teils als überzeichnet oder alarmistisch wahrgenommen wird. So wirkmächtig diese rhetorische Zuspitzung auch sein mag, so bedarf sie doch einer sorgfältigen Kontextualisierung und empirischen Fundierung, um nicht als analytische Übertreibung gelesen zu werden.
Dennoch gilt: Viele der von Graham identifizierten Trends – etwa die sicherheitspolitische Umcodierung öffentlicher Räume, die Ausdifferenzierung städtischer Kontrolltechnologien oder die ungleiche Mobilitätsverteilung – zeigen sich auch in europäischen Städten, wenn auch mit anderer Intensität und normativer Rahmung. Cities Under Siege kann daher auch für den deutschsprachigen Diskurs ein wichtiger Impulsgeber sein – vorausgesetzt, seine Thesen werden kritisch reflektiert, lokal adaptiert und empirisch überprüft.
Literatur und weiterführende Informationen
- Graham, S. (2010): Cities Under Siege: The New Military Urbanism. London: Verso Books.
- Rolnic, R. (2022): Urban Warfare: Housing under the Empire of Finance. London: Verso Books.
- Lezard, N. (2011, 13. Dezember). Cities Under Siege by Stephen Graham – review. The Guardian. https://www.theguardian.com/books/2011/dec/13/cities-under-siege-stephen-graham
- Steinmetz, G. (2012). Cities under Siege. Review by George Steinmetz. Society & Space. https://www.societyandspace.org/articles/cities-under-siege-by-stephen-graham
Video
Vortrag von Stephen Graham an der London School for Economics.