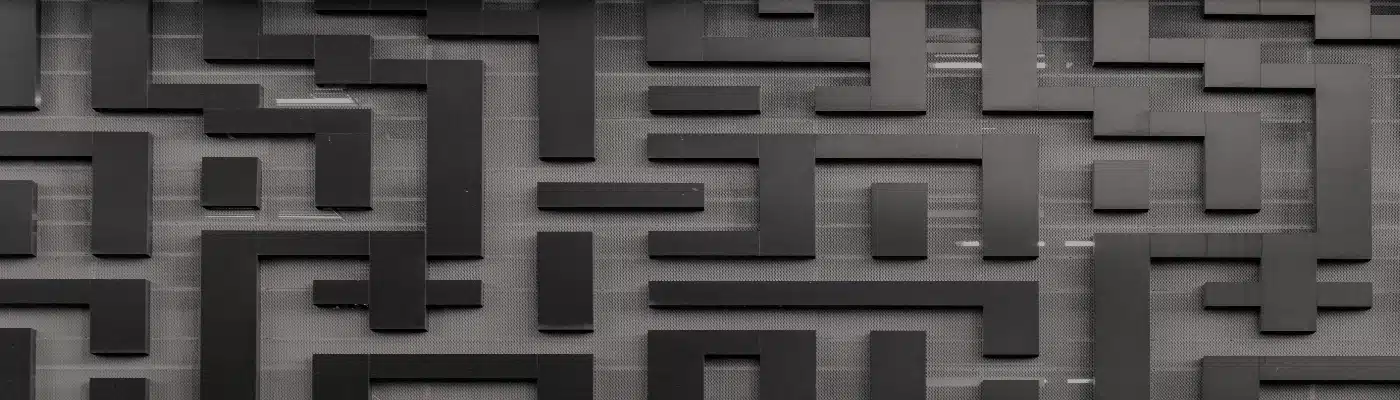
Kriminalität ist ein gesellschaftlich hoch emotionales Thema. Medienberichte, politische Debatten und Alltagsgespräche erzeugen bestimmte Bilder von Kriminalität, die mitunter verzerrt oder überzeichnet sind. Die Kriminologie zeigt jedoch, dass viele dieser Vorstellungen Mythen sind. Im Folgenden werden zwölf besonders verbreitete Mythen über Kriminalität vorgestellt und kritisch diskutiert.
1. „Kriminalität ist ein seltenes, außergewöhnliches Phänomen.“
Kriminalität erscheint oft als etwas Abnormales, das nur „anderen“ passiert. Die Ubiquitätsthese zeigt jedoch: Fast alle Menschen begehen im Laufe ihres Lebens Handlungen, die als Straftat gelten könnten. Die Dunkelfeldforschung weist darauf hin, dass viele Delikte nicht angezeigt werden. Bereits Émile Durkheim betonte, dass Devianz und Kriminalität normale Bestandteile jeder GesellschaftEine Gesellschaft ist ein strukturiertes Gefüge von Menschen, die innerhalb eines geografischen Raumes unter gemeinsamen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen leben und durch institutionalisierte soziale Beziehungen miteinander verbunden sind. sind.
Hinzu kommt die Alltäglichkeit solcher Erfahrungen: Viele Menschen werden im Laufe ihres Lebens Opfer von scheinbar „kleinen“ Delikten wie Beleidigungen oder Nötigungen im Straßenverkehr. Ebenso begehen die meisten selbst Regelverstöße – etwa Steuerbetrug im Kleinen oder Geschwindigkeitsüberschreitungen. Diese Beispiele verdeutlichen, dass Kriminalität nicht nur in extremen Fällen vorkommt, sondern Teil alltäglicher sozialer Realität ist.
2. „Die Kriminalität steigt ständig.“
Regelmäßig zeigen Bevölkerungsbefragungen, dass das Ausmaß insbesondere von Gewaltkriminalität deutlich überschätzt wird. Dieses Bild wird durch die mediale Logik („crime sells“) verstärkt: Gewalt- und Kapitaldelikte erhalten überproportional viel Aufmerksamkeit, obwohl sie zahlenmäßig nur einen kleinen Teil der Kriminalitätswirklichkeit ausmachen. Hinzu kommt eine politische Instrumentalisierung von Kriminalität, die in Wahlkämpfen und sicherheitspolitischen Debatten regelmäßig auftaucht. Ein Blick in die Polizeiliche Kriminalstatistik und die Dunkelfeldforschung zeigt hingegen: Viele Delikte sind rückläufig, und das objektive Kriminalitätsniveau ist deutlich stabiler, als es die öffentliche Wahrnehmung vermuten lässt.
3. „Kriminalität ist immer eindeutig böse.“
Ob ein Verhalten als kriminell gilt, hängt stark vom gesellschaftlichen und historischen Kontext ab. So galten etwa Cannabiskonsum oder Homosexualität in der Vergangenheit als Straftaten. Der Labeling Approach verdeutlicht, dass Kriminalität nicht allein in den Taten selbst begründet liegt, sondern auch durch soziale Zuschreibungen entsteht. Der US-amerikanische Soziologe Howard S. Becker formulierte prägnant: Abweichendes Verhalten ist ein Verhalten, das Menschen als solches bezeichnen.
4. „Härtere Strafen verhindern Kriminalität.“
Die Vorstellung, dass strengere Strafen automatisch für weniger Straftaten sorgen, ist weit verbreitet. Empirische Untersuchungen zeigen jedoch, dass nicht die Härte der StrafeStrafe ist eine soziale Reaktion auf normabweichendes Verhalten, bei der ein als negativ bewertetes Übel zugefügt wird – entweder informell durch soziale Gruppen oder formal durch staatliche Institutionen. entscheidend ist, sondern vor allem die Wahrscheinlichkeit, überhaupt entdeckt und sanktioniert zu werden. Kurze Freiheitsstrafen können sogar kontraproduktiv wirken, da sie soziale Bindungen schwächen und die Rückfallgefahr erhöhen. Immer wieder aufflammende Debatten über eine Absenkung der Strafmündigkeit oder die Einführung besonders harter Sanktionen wie der Todesstrafe oder „echter“ lebenslanger Haftstrafen verdecken, dass solche Maßnahmen nach kriminologischer Forschung nicht zu weniger Kriminalität führen. Wirksamer sind vielmehr Maßnahmen der PräventionVorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten oder sozialen Problemen. und sozialer Integration.
5. „Nur Menschen aus der Unterschicht werden kriminell.“
Kriminalität ist kein exklusives Phänomen sozial benachteiligter Gruppen. Zwar treten Eigentums- und Gewaltdelikte dort häufiger auf, doch Wirtschaftskriminalität und Organisierte Kriminalität finden sich eher in wohlhabenden Schichten – oft mit gravierenderen gesellschaftlichen Folgen, aber geringerer Sichtbarkeit. Hinzu kommt, dass polizeiliche Kontrollintensität und soziale Strukturen eine große Rolle spielen: Bestimmte Wohngebiete stehen stärker unter Beobachtung, während Delikte in privilegierten Milieus seltener entdeckt oder angezeigt werden. Theorien der sozialen Desorganisation zeigen zudem, dass Wohnort und Nachbarschaft entscheidend zur Erklärung von Kriminalitätsbelastungen beitragen. Der Soziologe Heinrich Popitz brachte es pointiert auf den Punkt: „Eine Dunkelziffer kann man sich kaufen – durch den Besitz eines Hauses.“
6. „Ausländer sind krimineller als Deutsche.“
Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist bei Nichtdeutschen zum Teil höhere Tatverdächtigenraten aus. Diese spiegeln jedoch häufig Unterschiede im Anzeigeverhalten, im Aufenthaltsstatus sowie in den sozioökonomischen Lebenslagen wider. Ein höheres „kriminelles Potenzial“ ist damit empirisch nicht belegt.
Darüber hinaus gilt ein biologischer Determinismus als Erklärung für Kriminalität seit über 100 Jahren als widerlegt. Schon die klassischen biologischen Kriminalitätstheorien wie die von Cesare Lombroso sind wissenschaftlich obsolet. Kriminalität wird heute vielmehr als Ergebnis sozialer, ökonomischer und kultureller Kontexte verstanden.
Das Thema Ausländerkriminalität wird in der Forschung differenziert betrachtet – pauschale Zuschreibungen erweisen sich als problematisch. Zugleich wird Kriminalität von Nichtdeutschen politisch und medial häufig instrumentalisiert, um bestimmte Narrative von Unsicherheit und Bedrohung zu stützen. Eine kritische Auseinandersetzung mit solchen Deutungen findet sich im Faktencheck zu Aussagen der AfD zur Inneren Sicherheit.
7. „Frauen werden hauptsächlich von Fremden vergewaltigt.“
Die meisten Sexualdelikte geschehen nicht in dunklen Parks durch unbekannte Täter, sondern im nahen sozialen Umfeld – durch Partner, Ex-Partner oder Bekannte. Der Mythos vom „fremden Täter“ verstellt den Blick auf das Ausmaß häuslicher und partnerschaftlicher Gewalt. Er begünstigt zudem Victim Blaming und kann Betroffene zur sekundären Viktimisierung führen.
Die Angst vor dem fremden Täter hat gesellschaftliche Folgen: Sie verstärkt die Kriminalitätsfurcht, führt zu Vermeidungs- und Schutzverhalten und kann dadurch das Entstehen von Angsträumen fördern. Ironischerweise sinkt dadurch die informelle soziale Kontrolle in öffentlichen Räumen, was tatsächlich Unsicherheit verstärken kann. Hinzu kommt, dass viele Delikte im DunkelfeldDas Dunkelfeld umfasst alle Straftaten, die nicht polizeilich bekannt oder statistisch erfasst werden. verbleiben, da das Anzeigeverhalten stark von der sozialen Nähe zum Täter beeinflusst wird.
8. „Kinderpornographie ist nur ein Problem älterer Männer.“
Auch Jugendliche und junge Erwachsene fallen häufig mit kinderpornographischen Inhalten auf – etwa durch den Austausch solcher Dateien im digitalen Raum. Das Bild des „einsamen alten Täters“ unterschlägt diese Realität und erschwert angemessene Prävention.
Ein Grund dafür liegt im veränderten Mediennutzungsverhalten: Der Zugang zu „normaler“ Pornographie ist durch Smartphones und Internet jederzeit möglich. Damit hat der Konsum pornographischer Inhalte seinen Charakter als jugendliche Mutprobe oder Tabubruch weitgehend verloren. In manchen Fällen führt dies dazu, dass Jugendliche neugierig auf extreme oder illegale Inhalte werden – sei es aus Grenzerprobung oder Gruppendruck.
Hinzu kommt das Phänomen des Sexting. Jugendliche können, oft ohne es zu wissen, durch das Versenden oder Weiterleiten von Nacktbildern Gleichaltriger in den Bereich strafbarer Kinder- oder Jugendpornographie geraten. Hier verschwimmen die Rollen von „Täter“ und „Opfer“ und machen deutlich, dass es sich nicht um ein rein „erwachsenes“ Problem handelt, sondern um eine Herausforderung der digitalen SozialisationSozialisation bezeichnet den Prozess, durch den Individuen die Werte, Normen, Verhaltensmuster und sozialen Rollen ihrer Gesellschaft erlernen und internalisieren. Dieser Prozess ermöglicht die Integration in soziale Gemeinschaften und die Entwicklung einer eigenen sozialen Identität..
9. „Clan-Kriminalität ist das zentrale Problem der inneren Sicherheit.“
Obwohl Clan-Kriminalität in der öffentlichen Debatte stark thematisiert wird, macht sie nur einen kleinen Teil der registrierten Delikte aus. Weit größere Schäden entstehen durch organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität, die deutlich weniger mediale und politische Aufmerksamkeit erhalten.
Die starke Fokussierung auf Clan-KriminalitätClan-Kriminalität bezeichnet ein politisch und medial geprägtes Schlagwort für bestimmte Formen von Kriminalität, die Angehörigen von Großfamilien mit Migrationshintergrund zugeschrieben werden. ist eng mit politischer Instrumentalisierung verbunden. Insbesondere im Kontext der Migrationsdebatten wurde Clan-Kriminalität zu einem Symbolthema, das fremdenfeindliche Ressentiments verstärken kann. Dies birgt die Gefahr einer „Sippenhaftung“, bei der nicht nur Einzelne, sondern ganze Familien oder ethnische Gruppen stigmatisiert werden.
Hinzu kommt, dass die Bekämpfung dieser zahlenmäßig vergleichsweise kleinen Kriminalitätsform erhebliche Ressourcen bindet, die im Kampf gegen die viel weitreichendere Organisierte Kriminalität fehlen. Die mediale Darstellung – etwa in Gangsta-RapSubgenre des Hip-Hop, das Gewalt, Straßenerfahrung, Macht und Marginalisierung thematisiert.-Texten oder Serien wie 4 Blocks – verstärkt das Bild einer übermächtigen Bedrohung und trägt zur Entstehung einer Moral Panic bei. So entsteht ein verzerrtes Bild, das wenig mit der tatsächlichen KriminalitätswirklichkeitDie Gesamtheit aller begangenen Straftaten, unabhängig davon, ob sie polizeilich erfasst werden oder unentdeckt bleiben. zu tun hat.
10. „Mörder und Vergewaltiger sind grundsätzlich ‚Monster‘.“
Schwere Straftaten werden in der öffentlichen Wahrnehmung häufig mit pathologischen „Monstern“ verbunden. Mediale Darstellungen von Serienmördern wie Jeffrey Dahmer, Ted Bundy oder Ed Gein haben das Bild geprägt, dass es sich bei Täter:innen um abartige Ausnahmepersönlichkeiten handelt. Tatsächlich stammen die meisten Täter:innen jedoch aus dem sozialen Nahumfeld, sind in die Gesellschaft integriert und handeln in spezifischen Kontexten.
Solche Zuschreibungen haben weitreichende Folgen: Sie verstärken punitiv geprägte Strafvorstellungen, erschweren differenzierte Analysen und können sogar praktische Hindernisse für die öffentliche Fahndung darstellen – denn die Bevölkerung sucht nach „Monstern“ und nicht nach möglichen Täter:innen im eigenen Umfeld. Die Etikettierungstheorie zeigt, dass solche Stigmatisierungen die soziale Realität eher verzerren und zur sekundären DevianzVerhalten, das in einer Gesellschaft als unangemessen, abweichend oder regelverletzend gilt – unabhängig davon, ob es strafrechtlich relevant ist. beitragen können.
11. „Mehr Polizei bedeutet automatisch weniger Kriminalität.“
Mehr Polizeistreifen können zwar das subjektive SicherheitsgefühlSicherheitsgefühl beschreibt das subjektive Empfinden einer Person, vor Kriminalität und Gefahren geschützt zu sein. steigern, doch die Polizeiarbeit ist in der Regel reaktiv. Viele Delikte werden erst nach ihrer Begehung registriert, und die Zahl der Fälle im Hellfeld hängt stark vom Anzeigeverhalten der Bevölkerung ab. Ein klassisches Beispiel ist der sogenannte Lüchow-Dannenberg-Effekt: Durch eine massive Erhöhung der Polizeipräsenz in einem Landkreis stieg nicht die tatsächliche Kriminalität, sondern lediglich die Zahl der registrierten Delikte. Dies zeigt, dass sichtbare Polizeipräsenz weniger VerbrechenEin Verbrechen ist eine besonders schwerwiegende Form rechtswidrigen Handelns, die im Strafrecht mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr bedroht ist – zugleich ist es ein sozial und historisch wandelbares Konstrukt. verhindert, sondern vor allem die Entdeckungswahrscheinlichkeit erhöht.
Wirksamer als reine Präsenz sind präventive Maßnahmen und soziale Unterstützung, die Ursachen von Kriminalität adressieren, anstatt lediglich deren Symptome zu kontrollieren.
12. „Gefängnisse resozialisieren Straftäter zuverlässig.“
Die im Strafvollzugsgesetz verankerte Resozialisierung bleibt in der Praxis häufig ein unerfülltes Ziel. Empirisch zeigen sich hohe Rückfallquoten, und insbesondere kurze Freiheitsstrafen können negative Effekte haben, da sie soziale Bindungen schwächen und die Chancen auf ein straffreies Leben nach der Haft verschlechtern.
In den 1970er Jahren sorgte die sogenannte „nothing works“-These, formuliert von Robert Martinson, für große Aufmerksamkeit. Sie stellte die Wirksamkeit von Resozialisierungsmaßnahmen grundsätzlich infrage und begünstigte einen kriminalpolitischen Paradigmenwechsel hin zu mehr Punitivität und sicherheitsorientierten Strategien. David Garland hat diesen Wandel in seiner Analyse der „Kultur der Kontrolle“ eindrücklich beschrieben. Strömungen wie der Abolitionismus oder Konzepte der Restorative Justice kritisieren diese Entwicklung und plädieren für alternative Formen des Umgangs mit Straftäter:innen, die auf Wiedergutmachung, soziale IntegrationIntegration bezeichnet den Prozess der Eingliederung von Personen oder Gruppen in eine bestehende Gesellschaft, bei dem sowohl Anpassung als auch Teilhabe angestrebt werden. und die Stärkung von sozialer Kontrolle setzen.
Fazit: Kriminalität ist kein Fremdkörper in der Gesellschaft, sondern ein Phänomen, das alle betrifft und vielfältige Ursachen hat. Die Auseinandersetzung mit verbreiteten Mythen hilft, differenzierter über Kriminalität, soziale Kontrolle und Strafpolitik zu diskutieren.


